Dieter Lamping, Simone Frieling: Allgemeinbildung, Werke der Weltliteratur
Aus dem Vorwort der Autoren: ... Es sind durchweg Texte, die auch ein junger Leser verstehen kann, selbst wenn ihm mancher von ihnen viel abverlangen dürfte. Natürlich hätten es noch mehr Titel sein können. Doch aus verschiednen Gründen werden bestimmte Bücher nicht vorgestellt; zum Beispiel weil sie nur für eine Zeit oder eine Nationalliteratur, aber nicht für die Weltliteratur wichtig waren (und sind). ... Es sind vor allem Werke der westlichen Literaturen, der europäischen und der amerikanischen, die in diesem Buch porträtiert werden - von der Antike bis in die Gegenwart und durch die Gattungen hindurch: Dramen, Gedichte, Erzählungen, Essays und Romane, kurze und lange, ernste und komische Texte. Der Übersichtlichkeit halber sind sie nach großen Zeiträumen angeordnet: Antike, Mittelalter, von der Renaissance bis zum Barock, von der Aufklärung bis zur Romantik, Realismus, Moderne und Gegenwart.
Beispiel weil sie nur für eine Zeit oder eine Nationalliteratur, aber nicht für die Weltliteratur wichtig waren (und sind). ... Es sind vor allem Werke der westlichen Literaturen, der europäischen und der amerikanischen, die in diesem Buch porträtiert werden - von der Antike bis in die Gegenwart und durch die Gattungen hindurch: Dramen, Gedichte, Erzählungen, Essays und Romane, kurze und lange, ernste und komische Texte. Der Übersichtlichkeit halber sind sie nach großen Zeiträumen angeordnet: Antike, Mittelalter, von der Renaissance bis zum Barock, von der Aufklärung bis zur Romantik, Realismus, Moderne und Gegenwart.
Jeweils eine Doppelseite ist einem Autor, einer Autorin bzw. einem Text gewidmet. Unter dessen fettgedrucktem Namen (mit den biographischen Daten) steht der Name des Textes, um den es geht, darunter die Gattungsbezeichnung (Roman, Erzählung, Essay usw.), das Datum der Erstveröffentlichung und eventuell Hinweise zur empfohlenen Übersetzung. Links und rechts des Haupttextes sind kurze Erklärungen eingefügt (was bedeutet..., wer war ..., was geschah ...), die helfen sollen, den Text einzuordnen. Am Ende erfährt man Anekdotisches und Nebensächliches im Kasten “Bemerkenswertes”.
Die klare Struktur, die Übersichtlichkeit und die leicht verständliche Sprache machen das Buch nicht nur zu einem lehrreichen Nachschlagewerk, sondern auch zu einem, das zum Stöbern und Querlesen einläd. Eine Empfehlung.
Arena Verlag, Würzburg 2015, 329 Seiten, Paperback, 8,99 Euro
Richard Latzin: Das Literaturquiz - Wie heißt das Buch?
Richard Lazins große Leidenschaft ist das Lesen. Denn auch er gehört zu der Spezies Mensch, die über der Lektüre eines guten Buches, es schon mal versäumen, an der richtigen Haltestelle die Straßenbahn oder den Bus zu verlassen. Und Latzin weiß, wie wichtig der erste Satz eines Buches ist, der ein Türöffner sein kann, ein Magnet, der den Leser mit Macht in die Geschichte hineinzieht.
Richard Lazin ist auch ein Rätselfreund, einer, der selber gerne rätselt aber auch ein diebisches Vergnügen daran hat, andere mit Rätseln herauszufordern. So entstand die Idee, ausgehend von den ‚Ersten Sätzen‘, Bücherrätsel zu schreiben. 220 Stück hat er in seinem Buch versammelt, immer eines pr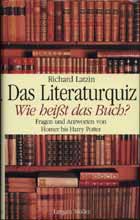 o Seite. Jedem ‚Ersten Satz‘ folgt ein kurzer Text, der die Handlung der Geschichte andeutet, Hinweise auf die handelnden Personen oder den Ort des Geschehens liefert, manchmal aber auch nur eine einzelne Szene beleuchtet. Und immer verbirgt sich dahinter die Frage: Um welches Buch handelt es sich? Ein Krimi? Ein Klassiker? Bücher von Aitmatov bis Zweig, von Homer bis Harry Potter sind dabei. Die Lösungen finden wir im Anhang beschrieben, jeweils fünf, sechs Zeilen lang.
o Seite. Jedem ‚Ersten Satz‘ folgt ein kurzer Text, der die Handlung der Geschichte andeutet, Hinweise auf die handelnden Personen oder den Ort des Geschehens liefert, manchmal aber auch nur eine einzelne Szene beleuchtet. Und immer verbirgt sich dahinter die Frage: Um welches Buch handelt es sich? Ein Krimi? Ein Klassiker? Bücher von Aitmatov bis Zweig, von Homer bis Harry Potter sind dabei. Die Lösungen finden wir im Anhang beschrieben, jeweils fünf, sechs Zeilen lang.
Dieses Buch ist eine nette Nebensächlichkeit, eine schöne Spielerei. Wer sich darauf einlässt, der wird seinen Spaß haben und die eine oder andere Anregung finden, “die ihm helfen kann bei der Suche nach den richtigen Büchern, nach dem ganz speziellen Lektüre-Erfolgserlebnis.” Nur frage ich mich, wer bereit ist knapp 15 Euro für das gebundene Buch auszugeben. Hier wäre eine kostengünstige Taschenbuchausgabe sicherlich angemessener gewesen.
Verlag Langen Müller, München 2004, 288 Seiten, geb. 14,90 Euro
Die Leseliste - kommentierte Empfehlungen (Reclam Verlag)
zusammengestellt von Sabine Griese, Hubert Kerschner, Albert Meier und Claudia Stockinger
Vornehmlich an Schüler, Lehrer und Studenten der Germanistik richten sich die AutorenInnen dieses kleinen gelben Reclam-Büchleins, denn gedacht ist vor allem an die Orientierungsbedürfnisse derer, die nicht ausschließlich zur Unterhaltung und zum poetischen Genuss, sondern mit fachlichem Interesse lesen wollen. (...) Der Auslese liegt die Überlegung zu Grunde, von welchen Autoren und Werken aus ein zuverlässiger, fachwissenschaftlich verantwortbarer Einstieg in den Entwicklungsgang namentlich der deutschen Literatur zu finden ist. (...) Ziel ist es, die Dynamik der Literaturgeschichte in markanten Werken zu benennen und besser erfahrbar zu machen. (aus den Vorbemerkungen) Unterteilt ist die Leseliste in drei Abteilungen: deutschsprachige Literatur, fremdsprachige Literaturen und Philosophie. Die deutschsprachige Literatur (mehr als die Hälfte des Gesamtumfangs) gliedert sich in die Kapitel Mittelalter, Humanismus und Reformation, Barock, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Biedermeier und Vormärz, Bürgerlicher Realismus, Naturalismus bis Expressionismus, Weimarer Republik und Drittes Reich, Literatur seit 1945 (BRD, Österreich, Schweiz), Literatur der DDR. Am Ende sind es mehr als 600 Titel, die hier in aller Kürze vorgestellt werden, denn für mehr als einige kommentierende Stichworte zu Inhalt und Bedeutung fehlt der Raum. Dabei geht der Text nur selten über vier bis fünf Zeilen hinaus. Beispiel: ADALBERT STIFTER: DER NACHSOMMER; Bildungsroman in drei Bänden; schildert unter Umgehung aller Störfaktoren eine ideale Entwicklung zum universal gebildeten Menschen nach klassischem Muster (Goethe, Wilhelm von Humboldt).
Unterteilt ist die Leseliste in drei Abteilungen: deutschsprachige Literatur, fremdsprachige Literaturen und Philosophie. Die deutschsprachige Literatur (mehr als die Hälfte des Gesamtumfangs) gliedert sich in die Kapitel Mittelalter, Humanismus und Reformation, Barock, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Biedermeier und Vormärz, Bürgerlicher Realismus, Naturalismus bis Expressionismus, Weimarer Republik und Drittes Reich, Literatur seit 1945 (BRD, Österreich, Schweiz), Literatur der DDR. Am Ende sind es mehr als 600 Titel, die hier in aller Kürze vorgestellt werden, denn für mehr als einige kommentierende Stichworte zu Inhalt und Bedeutung fehlt der Raum. Dabei geht der Text nur selten über vier bis fünf Zeilen hinaus. Beispiel: ADALBERT STIFTER: DER NACHSOMMER; Bildungsroman in drei Bänden; schildert unter Umgehung aller Störfaktoren eine ideale Entwicklung zum universal gebildeten Menschen nach klassischem Muster (Goethe, Wilhelm von Humboldt).
Fazit: Wirklich nur als reine Auflistung brauchbar (im direkten Vergleich zu anderen Listen), als Appetitmacher ungeeignet, dazu sind die Kommentare zu kurz.
Universal-Bibliothek Nr. 8900, Verlag Philipp Reclam, Stuttgart, 2002; Taschenbuch; 201 Seiten; 4,60 Euro
Listen - Rezensionszeitschrift
Wer nichts als Rezensionen erwartet, wird bei einem Blick in das Inhaltsverzeichnis überrascht sein. Auf den 60 durchweg schwarzweißen Seiten widmen sich gerade mal 18 Seiten Buchbesprechungen im eigentlichen Sinne. Im überwiegenden Teil finden wir Überschriften zu Themen wie Romane und Erzählungen, Biographie, Fotografie, Gesellschaft, Interview, Gedicht und Fernsichten, dazu jeweils ein Schwerpunktthema. Im Heft 63 zum Beispiel war es die Literaturszene Indiens: Unterwegs zwischen Himmel und Erde.
LISTEN erscheint viermal im Jahr im Axel Dielmann Verlag, Frankfurt am Main, in ausgewählten Buchhandlungen, Bahnhofsbuchhandlungen. Einzelpreis: 3,00 Euro, Abo-Preis: 15,00 Euro/ Jahr; (www.listen-rezensionen.de)
Das Literaturbuch
Das Literaturbuch stammt aus dem Londoner Verlag Dorling Kindersley, in dem bereits ganz ähnlich gestaltete Bücher zu den Themen Film, Geschichte, Management, Philosophie, Politik Psychologie, Religion, Soziologie, Wirtschaft, Wissenschaft und Astronomie erschienen sind. Das auf Hochglanzpapier gedruckte 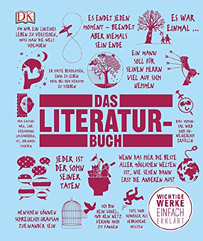 Buch ist kein Lexikon im eigentlichen Sinne. Vielmehr stellt es einen Streifzug durch die Literaturgeschichte dar. Es beginnt mit dem Gilgamesch-Epos und endet recht aktuell mit Michel Houellebecq. Leider ist die Übersetzung aus dem Englischen mit einigen Rechtschreibfehlern behaftet.
Buch ist kein Lexikon im eigentlichen Sinne. Vielmehr stellt es einen Streifzug durch die Literaturgeschichte dar. Es beginnt mit dem Gilgamesch-Epos und endet recht aktuell mit Michel Houellebecq. Leider ist die Übersetzung aus dem Englischen mit einigen Rechtschreibfehlern behaftet.
Aus der Einleitung: Das Literaturbuch unternimmt eine Reise durch die Literaturgeschichte der ganzen Welt. Als Wegmarke dienen mehr als 100 literarische Texte aus verschiedenen Kulturkreisen, so dass der Leser auch die eine oder andere Neuentdeckung machen wird. Die ausgewählten Werke repräsentieren jeweils eine Epoche oder einen Stil oder stellen eine literarische Strömung vor, deren Ansatz von anderen zeitgenössischen Autoren aufgegriffen und von nachfolgenden Generationen weiterentwickelt wurde. Die Werke sind chronologisch geordnet, um die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe literarischer Neuerungen zu verdeutlichen ...
Die einzelnen Artikel sind ein bis vier Seiten lang und werden durch Zeichnungen, Fotos, Tabellen und Grafiken illustriert. Neben Zitaten und biographischen Angaben zum Leben des Autors finden wir im Kasten “Im Kontext” hilfreiche Hinweise zur zeitlichen Einordnung des besprochenen Werkes. Fazit: ein lehrreiches Buch.
Dorling Kindersley Verlag GmbH, München, 2017, Hardcover, 352 Seiten, 24,95 Euro
Literaturen - Das Journal für Bücher und Themen
Das erste Heft der Literaturen erschien im Oktober 2000. Seitdem ist die unter der Leitung von Sigrid Löffler herausgegebene Zeitschrift zum festen Bestandteil der Literaturszene geworden. Neben einem stets wechselnden Schwerpunktthema bietet es seinen Leserinnen und Lesern Buchbesprechungen, Interviews, Autorenporträts, Leseproben, ein Literaturrätsel und vieles andere. Das 100 bis 120 Seiten starke Einzelheft kostet 7,50 Euro, das Doppelheft 9,90 Euro, ein Jahresabonnement für 12 Ausgaben 77,00 Euro.
Ich halte die Literaturen für eine wirkliche Bereicherung der Literaturlandschaft. Auch wenn man die Kosten für ein Jahresabonnement scheut, lohnt es sich hin und wieder doch, die eine oder andere Ausgabe in die Hand zu nehmen.
Jürgen Lodemann (Hsg.):
Die besten Bücher - Ein Ratgeber für die neueste Literatur
Aus dem Klappentext: Seit über zwanzig Jahren empfehlen alle vier Wochen dreißig und mehr Literaturkritiker aus Österreich, der Schweiz und Deutschland diejenigen neuen Bücher, “denen sie möglichst viele Leser wünschen”. Die Summe dieser Empfehlungen ergibt einen Ratgeber für die jüngere moderne Literatur. Wer wissen möchte, welches Buch der letzten 20 Jahre Bestand haben wird, welches Buch er schon immer einmal lesen wollte, kann sich hier Rat und Information holen.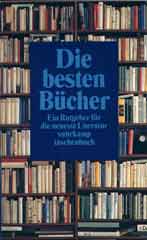
Die Bestenliste macht 60 Seiten des Mittelteils des schmalen Taschenbuches aus. Sie reicht von März 1975 bis Juni 1995. Neben der Platzierung sind angegeben: Name des Autors, Titel des Buches, der Verlag und die Anzahl der vergebenen Punkte. Es gibt keine Angaben zu Inhalt und Bedeutung. Von daher ist es hier mit Rat und Information - wie im Vorwort beschworen - nicht weit her. Die Liste wird eingerahmt von einigen mehr oder weniger interessanten Essays einiger der Kritiker(innen) und einem erhellenden Rückblick Jürgen Lodemanns auf die Anfänge der Bestenliste mit dem Titel: “Nichts als Bücher im Kopf? Warum und wie diese Bestenliste erzeugt und erzogen wurde”.
Fazit: Mehr als nette Erinnerungen an die Bücher, (über) die man vor Jahren gelesen oder auch nicht gelesen hat, bietet das Buch nicht. Schließlich lebt doch die Liste von ihrem Bezug zum aktuellen Angebot auf dem Buchmarkt. Von daher ist sie ebenso interessant wie der Wetterbericht von vorgestern. Wer mehr wissen will, dem sei die Online-Version der Bestenliste empfohlen. Hier sind die Empfehlungen ab 1995 nachzulesen. Außerdem gibt’s hier Tipps zu den Literatursendungen im Fernsehen des Südwestrundfunks.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995; Suhrkamp Taschenbuch 2492; 184 Seiten, 7,50 Euro
Katharina Mahrenholtz und Dawn Parisi: Literatur! - Eine Reise durch die Welt der Bücher
Sicher, werden Sie sagen, wieder eines von diesen “Listen”-Büchern. Eines wie ‘Die fünfzig besten Bücher des 20. Jahrhunderts’, ‘44 Bücher, die man gelesen haben muss’, ‘ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher’, ‘Bücher - alles, was man lesen muss’, ‘100 Romane für alle Lebenslagen’ usw. usw. Wir haben sie alle hier besprochen. Shakespeare, Defoe,  Goethe, Tolstoi, Thomas Mann, Proust, Kafka, Camus, Frisch, Lenz und Grass. Immer das gleiche: kurze Inhaltsangabe, Bedeutung für die Weltliteratur, ein Zitat, vielleicht ein Foto ... umblättern, nächste Seite. Alles schon mal dagewesen, meinen Sie? Falsch ... das Buch von Katharina Mahrenholtz und Dawn Parisi ist anders ... besser ... schöner. Natürlich sind alle einschlägig Verdächtigen auch hier dabei, siehe oben. Natürlich auch hier Inhaltsangabe, Zitat und all das.
Goethe, Tolstoi, Thomas Mann, Proust, Kafka, Camus, Frisch, Lenz und Grass. Immer das gleiche: kurze Inhaltsangabe, Bedeutung für die Weltliteratur, ein Zitat, vielleicht ein Foto ... umblättern, nächste Seite. Alles schon mal dagewesen, meinen Sie? Falsch ... das Buch von Katharina Mahrenholtz und Dawn Parisi ist anders ... besser ... schöner. Natürlich sind alle einschlägig Verdächtigen auch hier dabei, siehe oben. Natürlich auch hier Inhaltsangabe, Zitat und all das.
Der Mehrwert dieses Buches besteht jedoch in den kleinen charakteristischen Porträtzeichnungen, die jede Seite begleiten, in der Timeline, die am unteren Seitenrand entlangläuft und das jeweilige Werk zeitlich einzuordnen hilft, in den eingeschobenen Bemerkungen wie ‘Smalltalk-Info’ und ‘Für Einsteiger’, in den erklärenden Zusatzinformationen wie ‘Was ist eigentlich noch mal Lyrik, Drama, Epik, Roman, Erzählung ...’, in Kapiteln wie ‘Literaturhelden in Europa’, ‘Literaturnetz’ (eine Art U-Bahn-Streckenkarte mit Autorennamen), ‘berühmte und schöne Buchanfänge’, Lektüre-Vorschläge für Leichtleser und Biographieliebhaber, lange Sätze, Autoren und deren Pseudonyme, Bestseller als graphisches Diagramm, die wichtigsten Literaturpreise, die stärksten Krimis, die gefühlvollsten Liebesromane, und eine Sternkarte, die den ganzen Kosmos der Literatur umfasst. Der Mehrwert liegt auch in den comic-haften ganzseitigen Zeichnungen, die komplizierte Romanhandlungen oder verworrene verwandtschaftliche Beziehungen der Romanhelden erläutern und in den immer wieder eingeschobenen Kapiteln ‘Kurz und wichtig - Literatur im Schnelldurchlauf’, die Werke berücksichtigen, die bei der Fülle des Stoffes sonst unerwähnt blieben.
Mag sein, dass man zunächst den Eindruck gewinnt, es handle sich hierbei um ein Kinderbuch. Das ist es aber nicht. Es wendet sich an alle Literaturliebhaber, egal ob jung oder alt. Ein Buch zum Stöbern und Querlesen. Ein Buch zum Verschenken und natürlich zum Selberlesen.
Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg, 2012; geb. 189 Seiten; 19,99 Euro
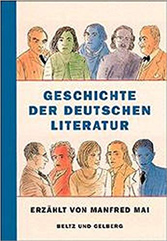 Manfred Mai: Geschichte der deutschen Literatur
Manfred Mai: Geschichte der deutschen Literatur
Dieses Buch richtet sich in erster Linie an junge Leser. Es ist einfach und übersichtlich aufgebaut, gut strukturiert und in der Sprache kurz und knapp gehalten. Der Text schweift nicht ab. Mann kann ihm gut folgen. Sehr hilfreich sind die zahlreichen Original-Texte, die die besprochen Werke illustrieren und verständlich machen. All das macht das Buch für jeden interessant, auch für ältere Leser. Ich habe es gelesen wie einen Roman.
Da das Buch allerdings schon 2001 erschienen ist, endet die darin besprochene Literaturgeschichte bereits mit der deutschen Wiedervereinigung. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Günter Grass und seinem Roman EIN WEITES FELD.
Nachtrag: Offenbar gibt es eine Neuauflage dieses Werkes. Es ist deutlich umfangreicher als die Ausgabe von 2001 und reicht wohl näher an die Gegenwart heran.
Verlag Beltz & Geberg, Weinheim und Basel 2001, 166 Seiten, fester Einband
Rainer Moritz: Die Überlebensbibliothek - Bücher für alle Lebenslagen
Aus dem Klappentext: “Wer das Leben bestehen und das Glück spüren will, braucht Bücher. In seiner ÜBERLEBENSBIBLIOTHEK schreibt Rainer Moritz über Romane, die die Macht haben, uns und unser Leben zu verändern, die uns in allen möglichen Lebenslagen die beste Freundin ersetzen - oder den Therapeuten. ...” 66 solcher Beschreibungen hat Rainer Moritz in seinem Kompendium versammelt, geordnet in 9 Kapiteln. Sie heißen: Mit sich selbst zurecht kommen; Mit Schwächen und Lastern leben; Das Leben bestehen, im Kleinen wie im Großen; Sich an fremde Orte begeben; Mit anderen Menschen zurechtkommen (oder auch nicht); Über Gott und die Welt nachdenken; Im Durcheinander von Erotik, Sex und Liebe klüger werden und Mit existenziellen Erfahrungen zurechtkommen. Moritz’ Texte sind vier, selten fünf Buchseiten lang. Sie kommen im Plauderton daher, sind kurzweilig und vergnüglich zu lesen. Nach kurzer Inhaltsangabe des betreffenden Buches, kommt der Autor schnell auf den Punkt, zeigt auf, worin das Charakteristische besteht und welche Aussage des Werkes es für ihn im Sinne der ÜBERLEBENSBIBLIOTHEK relevant erscheinen lässt. Ein paar Beispiele aus dem Inhaltsverzeichnis? Bitte sehr: Wer beabsichtigt, dauerhaft mit seiner Mutter zusammenzuleben, lese: Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin; Wer Sex im Alter für normal hält, lese: Philip Roth, Sabbaths Theater; Wer in Erwägung zieht, ein Häuschen vor der Stadt zu beziehen, lese: Richard Yates, Zeiten des Aufruhrs; Wer Pro- und Contra-Argumente für das moralisch noch nicht völlig akzeptierte Leben mit zwei Partnern sucht, lese: Wilhelm Genazino, Die Liebesblödigkeit; und Wer nirgendwo mehr ein Hoffnungslichtlein sieht, lese: Karen Duve, Weihnachten mit Thomas Müller. Weitere Autoren sind: Delius, Flaubert, Fontane, Grillparzer, Handke, Kästner, Krabbé; McEwan, Melville, Modick, Muschg, Ortheil, Proust, Stifter, Trevor, Twain, Valentin und viele andere. Neu ist das alles jedoch nicht. Irgendwo hat man das alles schon mal so oder so ähnlich gelesen. Aber da wir uns ja immer wieder gern aufs Neue an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, so ist auch dies Buch eine Empfehlung, denn (Klappentext) “... wer nicht die Zeit hat für alle dicken Bücher aller Autoren, nehme von Thomas Mann Das Eisenbahnunglück oder eben: DIE ÜBERLEBENSBIBLIOTHEK.
Piper Verlag, München 2006, gebunden, 309 Seiten, 19,90 Euro
Werner Morlang:
So schön beiseit - Sonderlinge und Sonderfälle der Weltliteratur
Aus dem Klappentext: “Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dies Buch an.” (Georg Christoph Lichtenberg)
Werner Morlang geht es in demselben keineswegs um ein literaturgeschichtliches Kuriositätenkabinett. Im Gegenteil! Ob Gedicht oder episch ausschweifendes Gebilde, Beziehungs- oder Kriminalgeschichte, ländliche Satire oder großstädtischer Schelmenroman, autobiographische Erzählung oder vorgetäuschte Historie, alle hier präsentierten Werke entschädigen - folgt man Lichtenbergs Appell - für die notfalls geschrumpfte Garderobe mit einem hochgradigen  Lesevergnügen. Morlang versteht seine literarischen Vorlieben als `Sonderling´, Außenseiter zumeist, die unabhängig von Moden und äußeren Bewertungsinstanzen ganz ihrer dichterischen Eigenart verpflichtet waren und solche Konsequenz oft mit einem schwierigen Leben bezahlten. Doch gerade dieser existenzielle Einschlag hat ihren Büchern eine erstaunliche Frische bewahrt, die manch einst gefeierten und mittlerweile zu Klassikern geadelten Werken abgeht.
Lesevergnügen. Morlang versteht seine literarischen Vorlieben als `Sonderling´, Außenseiter zumeist, die unabhängig von Moden und äußeren Bewertungsinstanzen ganz ihrer dichterischen Eigenart verpflichtet waren und solche Konsequenz oft mit einem schwierigen Leben bezahlten. Doch gerade dieser existenzielle Einschlag hat ihren Büchern eine erstaunliche Frische bewahrt, die manch einst gefeierten und mittlerweile zu Klassikern geadelten Werken abgeht.
Natürlich ist die Auswahl der Namen, die Werner Morlang uns hier präsentiert eine sehr subjektive. Das wundert uns nicht und ist auch gut so. Trotzdem kommt es uns etwas befremdlich vor, wenn so bekannte AutorenInnen wie Jean Paul, John Cowper Powys oder Anna Seghers als Außenseiter bezeichnet werden. Doch Morlang geht es hier tatsächlich eher um die Entstehungsgeschichte ihrer weniger bekannten Werke.
Auszug aus dem Inhalt: Steen Steensen Blicher: Bruchstücke aus dem Tagebuch eines Dorfküsters; Emmanuel Bove: Armand; Lena Christ: Erinnerungen einer Überflüssigen; Leonid Dobytschin: Die Stadt N; David Goodis: Schießen Sie auf den Pianisten; Hermann Grab: Der Stadtpark; Henry Green: Der Butler; Karl von Holtei: Schwarzwaldau; Yasushi Inoue: Meine Mutter; Wenedikt Jerofejew: Die Reise nach Petuschki; Hans Lebert: Die Wolfshaut; Arthur Machen: Der Berg der Träume; Horace McCoy: Ums nackte Leben; Johann Wilhelm Meinhold: Die Bernsteinhexe; Antonio Porchia: Stimmen/ Voces; Rahel Sanzara: Das verlorene Kind; Fjodor Sologub: Der kleine Dämon; Italo Svevo: Ein gelungener Scherz ...
Das Buch lässt sich wunderbar quer lesen. Die Kapitel sind nicht länger als vier Seiten. Schnell hat man sich mit dem einen oder anderen Autor, oder Autorin angefreundet und bekommt Lust auf mehr.
Verlag Nagel & Kimche, Zürich 2001; 230 Seiten; 19,90 Euro
Neckam, Jürgen: 500 Romane in einem Satz, das schnellste Literaturlexikon der Welt
500 Romane, zusammengefasst in jeweils nur einem einzigen Satz? Kann das gut gehen? Kann das mehr sein als ein Spaß? Wohl kaum, denn das Buch ist eines mit Sicherheit nicht: ein Literaturlexikon. Das kann es nicht sein und das will es auch gar nicht, wie Jürgen Neckam im Vorwort auch freimütig zugibt: Wofür es nicht in erster Linie da sein kann, weil es den Rahmen gesprengt hätte: für biografische Hintergründe, Charakteranalysen, intertextuelle Verweise, Stil- und Sprachuntersuchungen. Was also soll das Buch? Es soll einen prägnanten Überblick über den Inhalt der Romane geben, sagt der Autor, Erinnerungen an Lieblingsbücher wachrufen und als Appetizer für die Lektüre noch unbekannter Werke dienen. Und so ist es letztlich nichts anderes als eine Verbeugung vor der Literatur. - Vor allem eine Verbeugung vor den Großen des 19. und 20. Jahrhunderts: Von A wie Adams bis Z wie Zweig sind alle vertreten - die üblichen Verdächtigen eben. Namen wie Amélie Nothomb, Christian Kracht und Sven Regener stehen für die Gegenwartsliteratur. Und Daniel Kehlmann natürlich. Dessen Bestseller DIE VERMESSUNG DER WELT ist der jüngste der im Buch erwähnten Romane. Etwa sechs bis zehn Zeilen sind Neckams Einzelsätze in der Regel lang. Ergänzt werden sie durch den - nette Idee - besten Satz, einem Zitat aus dem jeweiligen Roman, das diesen zu charakterisieren helfen soll. Einmal muss Jürgen Neckam allerdings passen: Beim MANN OHNE EIGENSCHAFTEN. Musils epochaler 2.000 Seiten-Schmöker lässt sich nun wirklich nicht in einem Satz zusammenfassen.
Fazit: Dies ist ein Buch ohne wirklichen Gebrauchswert (zuwenig Autoren, zuwenig Bücher, selbst ein Inhaltsverzeichnis fehlt), jedoch ein Buch zum Blättern, zum Querlesen - ein Spaß eben, eine kleine Freude, die der Autor sich und uns Lesern hier macht, eben eine Verbeugung vor der Literatur - nicht mehr und nicht weniger.
DuMont Buchverlag, Köln 2007; geb., 272 Seiten; 14,90 Euro
The New York Times: The 100 Best Books of the 21th Century
Auch die renommierte New York Times hat 2024 einen Kanon erstellt Mehr als 500 Personen haben an der Abstimmung teilgenommen, Roman- und Sachbuch-Autoren/innen, Lyriker/innen, Kritiker/innen und eine große Anzahl Leser und Leserinnen. Da die englischsprachigen Titel auf dieser Liste deutlich überwiegen, ist anzunehmen, dass die Befragten überwiegend aus den USA stammen. Erstaunlich dann doch: Auf Platz eins steht eine italienische Autorin, Elena Ferrante mit “L’amica geniale” (deutsch: Meine geniale Freundin).
 |
Link: The 100 Best Books of the 21th Century
Hanns-Josef Ortheil: Lesehunger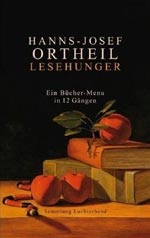 Stellen Sie sich vor: Stuttgart, ein sonniger Tag, Hanns-Josef Ortheil im Garten seines Eisenbahnerhäuschens mit Blick hinunter ins Tal, um ihn herum üppiges Grün, an seiner Seite eine imaginäre Besucherin. Ortheil führt seine Besucherin umher: Terrasse, Gartenhaus, Weinberghäuschen, die Küche des Wohnhauses, die Obstwiese. Die imaginäre Besucherin fungiert als Stichwortgeberin und der Dichter erzählt. Über die Verbindung des Schreibens mit bestimmten Orten („Die Verortung des Dichters im Raum“), Lektüre, Küche, Kochen und Lesen in der Küche, dazu passend und immer wieder: Venedig und Rom, die höchste Kunst der Literatur: der Essay, Ortheils Vorliebe für die klassische chinesische und japanische Literatur („Han-Jo in seiner Bambushütte“), Lesen unterwegs (Literarische Führer, Reiseliteratur), schließlich vom Lesen an und für sich, mit Büchern in Gesellschaft und die Auswahl des richtigen Lesestoffs. In angemessen gemächlichem Plauderton schreitet Ortheil voran und durchstreift dabei sprunghaft den ganzen literarischen Kosmos: Hemingway, Goethe, Woody Allen, Johannes Rau, Rilke, Yamamoto, Konfuzius, Annemarie Schimmel, Montaigne, Harald Schmidt, Harry Rowohlt, Christine Neubauer, Edith Wharton, Petrarca, Koeppen, Italo Svevo, Proust, Eco, Roland Barthes und Jurek Becker, um nur einige zu nennen, dazu - dem Titel des Buches entsprechend - natürlich jede Menge Bücher zum Thema Essen und Kochen. Das ist kurzweilig und lehrreich zugleich (jedes der zwölf Kapitel endet mit einer Leseliste). Trotzdem hat man das Gefühl durch ein imaginäres Museum geführt zu werden von einem Führer, der jedes Exponat bis ins Detail zu beschreiben weiß, von sich selbst aber nichts preisgeben will. Über die Literatur hinaus erfahren wir wenig über die Person Hanns-Josef Ortheil. Nichts über die Vordergründigkeiten seines Lebens, seine Familie oder sein literarisches Werk. Das erstaunlichste: nicht einmal die Musik kommt vor. Der Autor und ausgebildete Pianist Ortheil beschränkt sich hier tatsächlich auf die Literatur und auf das, was sie zu bewirken vermag. Am interessantesten ist LESEHUNGER jedoch immer dann, wenn der Vielschreiber und „Vielnotierer“ Ortheil zu einem seiner Notizbücher greift und seiner Besucherin einen längeren, zum jeweiligen Thema passenden Tagebucheintrag vorliest. Dann erkennen wir ihn wieder, den Autor so wunderbarer Romane wie DIE GROSSE LIEBE, DAS VERLANGEN NACH LIEBE und DIE GEHEIMEN STUNDEN DER NACHT.
Stellen Sie sich vor: Stuttgart, ein sonniger Tag, Hanns-Josef Ortheil im Garten seines Eisenbahnerhäuschens mit Blick hinunter ins Tal, um ihn herum üppiges Grün, an seiner Seite eine imaginäre Besucherin. Ortheil führt seine Besucherin umher: Terrasse, Gartenhaus, Weinberghäuschen, die Küche des Wohnhauses, die Obstwiese. Die imaginäre Besucherin fungiert als Stichwortgeberin und der Dichter erzählt. Über die Verbindung des Schreibens mit bestimmten Orten („Die Verortung des Dichters im Raum“), Lektüre, Küche, Kochen und Lesen in der Küche, dazu passend und immer wieder: Venedig und Rom, die höchste Kunst der Literatur: der Essay, Ortheils Vorliebe für die klassische chinesische und japanische Literatur („Han-Jo in seiner Bambushütte“), Lesen unterwegs (Literarische Führer, Reiseliteratur), schließlich vom Lesen an und für sich, mit Büchern in Gesellschaft und die Auswahl des richtigen Lesestoffs. In angemessen gemächlichem Plauderton schreitet Ortheil voran und durchstreift dabei sprunghaft den ganzen literarischen Kosmos: Hemingway, Goethe, Woody Allen, Johannes Rau, Rilke, Yamamoto, Konfuzius, Annemarie Schimmel, Montaigne, Harald Schmidt, Harry Rowohlt, Christine Neubauer, Edith Wharton, Petrarca, Koeppen, Italo Svevo, Proust, Eco, Roland Barthes und Jurek Becker, um nur einige zu nennen, dazu - dem Titel des Buches entsprechend - natürlich jede Menge Bücher zum Thema Essen und Kochen. Das ist kurzweilig und lehrreich zugleich (jedes der zwölf Kapitel endet mit einer Leseliste). Trotzdem hat man das Gefühl durch ein imaginäres Museum geführt zu werden von einem Führer, der jedes Exponat bis ins Detail zu beschreiben weiß, von sich selbst aber nichts preisgeben will. Über die Literatur hinaus erfahren wir wenig über die Person Hanns-Josef Ortheil. Nichts über die Vordergründigkeiten seines Lebens, seine Familie oder sein literarisches Werk. Das erstaunlichste: nicht einmal die Musik kommt vor. Der Autor und ausgebildete Pianist Ortheil beschränkt sich hier tatsächlich auf die Literatur und auf das, was sie zu bewirken vermag. Am interessantesten ist LESEHUNGER jedoch immer dann, wenn der Vielschreiber und „Vielnotierer“ Ortheil zu einem seiner Notizbücher greift und seiner Besucherin einen längeren, zum jeweiligen Thema passenden Tagebucheintrag vorliest. Dann erkennen wir ihn wieder, den Autor so wunderbarer Romane wie DIE GROSSE LIEBE, DAS VERLANGEN NACH LIEBE und DIE GEHEIMEN STUNDEN DER NACHT.
Luchterhand Literaturverlag, München 2009, Paperback, 235 Seiten, 8,00 Euro
Alexander Pechmann: Die Bibliothek der verlorenen Bücher
Was wäre, hätte man Hemingway seinerzeit nicht seine mit Manuskripten reich gefüllte Reisetasche gestohlen, hätte Thomas Mann nicht seine privaten Tagebücher verbrannt oder hätte Thomas Hardy im richtigen Augenblick Papier und Bleistift zur Hand gehabt? Die Literatur wäre zweifellos um einige interessante Werke reicher. Warum diese Bücher aber nie geschrieben worden sind, erfahren wir aus Alexander Pechmanns DIE BIBLIOTHEK DER VERLORENEN BÜCHER. Und nicht nur das. Das Buch ist voll von kleinen Geschichten, Anekdoten und biographischen Details aus dem Leben so bedeutender Autoren wie Malcolm Lowry, Lord Byron, Mary Shelley, Oscar Wilde, Kafka, Melville, Balzac, Dostojewski, Puschkin, Flaubert, Goethe, Mérimée, Ovid, Poe und vielen anderen. - Ein höchst unterhaltsames Buch.
Aufbau Verlag, Berlin 2007, Hbl, 226 Seiten, 18,95 Euro
Annette Pehnt, Friedemann Holder, Michael Staiger: Die Bibliothek der unge-
schriebenen Bücher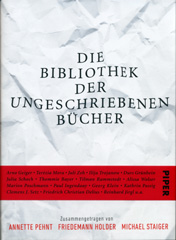 Man hätte das Buch auch “Die Bibliothek der verworfenen Buchtitel” nennen können. Geht es in vielen der kurzen Texte doch um kaum mehr als die Frage nach dem geeignetsten Titel, etwa nach der Methode: Ich wollte Titel A, mein Lektor war dagegen, also wurde es Titel B. Sehr unergiebig das ganze. Allerdings sind diese Beiträge in der Minderheit. Zum Glück beschäftigen sich die meisten Texte mit (aus den vielfältigsten Gründen) verworfenen Buchprojekten, also ungeschriebenen Romanen, Erzählungen und Lyrikbänden. Doch auch diese kurzen Aufsätze verweigern den von uns Lesern ersehnten Blick in die Schreibwerkstatt der vorgestellten Autoren und Autorinnen. Die Texte sind zu kurz, enthalten nichts Anekdotenhaftes, bleiben an der Oberfläche. Lediglich die zu jedem ungeschriebenen Buch gestalteten Buchcover von Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und der Fachhochschule Bielefeld sind interessant anzuschauen. Ein Buch ohne Mehrwert und für 24,99 Euro viel zu teuer. Wir empfehlen daher “Die Bibliothek der verlorenen Bücher” von Alexander Pechmann (siehe oben).
Man hätte das Buch auch “Die Bibliothek der verworfenen Buchtitel” nennen können. Geht es in vielen der kurzen Texte doch um kaum mehr als die Frage nach dem geeignetsten Titel, etwa nach der Methode: Ich wollte Titel A, mein Lektor war dagegen, also wurde es Titel B. Sehr unergiebig das ganze. Allerdings sind diese Beiträge in der Minderheit. Zum Glück beschäftigen sich die meisten Texte mit (aus den vielfältigsten Gründen) verworfenen Buchprojekten, also ungeschriebenen Romanen, Erzählungen und Lyrikbänden. Doch auch diese kurzen Aufsätze verweigern den von uns Lesern ersehnten Blick in die Schreibwerkstatt der vorgestellten Autoren und Autorinnen. Die Texte sind zu kurz, enthalten nichts Anekdotenhaftes, bleiben an der Oberfläche. Lediglich die zu jedem ungeschriebenen Buch gestalteten Buchcover von Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und der Fachhochschule Bielefeld sind interessant anzuschauen. Ein Buch ohne Mehrwert und für 24,99 Euro viel zu teuer. Wir empfehlen daher “Die Bibliothek der verlorenen Bücher” von Alexander Pechmann (siehe oben).
Piper Verlag, München 2014, HC, 223 Seiten, 24,99 Euro
Daniel Pennac: Wie ein Roman
“Lies doch mal ein Buch.” “Geh in dein Zimmer und lies.” Nein, so geht das nicht. Kinder und Jugendliche kann man nicht zum Lesen zwingen. Man muss ihre Begeisterung wecken. Und wie? Durch vorlesen, vorlesen, vorlesen. Daniel Pennacs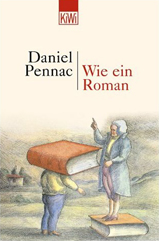 Ratschlag ist nicht neu und doch ohne Alternative. Es gilt ein bibliophiles Umfeld zu schaffen, in dem die Begeisterung fürs Lesen gedeihen kann wie eine Pflanze auf fruchtbarem Boden. Daniel Pennac muss es wissen. Der französische Romanautor ist Vater eines Sohnes und hat mehr als zwei Jahrzehnte als Lehrer gearbeitet. Am Ende seines Buches wirbt Pennac für die unantastbaren Grundrechte aller Leser, deren wichtigstes ist: nicht zu lesen, die Verweigerung der Lektüre, aber auch: Seiten zu überspringen, quer zu lesen oder auch ein Buch nicht zu Ende zu lesen und vor allem über das Gelesene zu schweigen.
Ratschlag ist nicht neu und doch ohne Alternative. Es gilt ein bibliophiles Umfeld zu schaffen, in dem die Begeisterung fürs Lesen gedeihen kann wie eine Pflanze auf fruchtbarem Boden. Daniel Pennac muss es wissen. Der französische Romanautor ist Vater eines Sohnes und hat mehr als zwei Jahrzehnte als Lehrer gearbeitet. Am Ende seines Buches wirbt Pennac für die unantastbaren Grundrechte aller Leser, deren wichtigstes ist: nicht zu lesen, die Verweigerung der Lektüre, aber auch: Seiten zu überspringen, quer zu lesen oder auch ein Buch nicht zu Ende zu lesen und vor allem über das Gelesene zu schweigen.
Daniel Pennac umkreist sein Thema mit großem Abstand. Vieles bleibt oberflächlich, manches gar langweilig. Eine tiefe Beziehung zwischen Autor und Leser mag sich so nicht einstellen. Vielleicht sei an dieser Stelle auf ein Buch verwiesen, das sich einem ganz ähnlichen Thema widmet, dabei den Leser jedoch tief in seinem Innern zu berühren versteht: WENN EIN KIND AN EINEM SOMMERMORGEN, Brief an meinen Sohn über die Liebe zu Büchern von Roberto Cotroneo. (siehe: Sekundäres A-K/Cotroneo)
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1994, 2004, Taschenbuch, 198 Seiten, 7,95 Euro
Nele Pollatschek: Pollatscheks Kanon - Weltliteratur zum Mitreden
Nele Pollatschek, 1988 in Berlin geboren, ist Autorin und Literaturwissenschaftlerin, hat in Oxford promoviert und ist nach eigenem Bekunden passionierte (Viel-)Leserin. Auch sie hat einen ganz persönlichen, unkonventionellen Literaturkanon zusammengestellt. Der ist nicht nachzulesen, sondern zu hören, im Radio auf HR2 Kultur. Die Beiträge im Feature-Format sind ca. vier Minuten lang und wurden als Teil der Sendung Kulturfrühstück ausgestrahlt, jeweils Mittwochs um 8.30 Uhr und sind möglicherweise noch als Pottcast abrufbar unter: HR2 Kultur.
Karl Hugo Pruys: Die Bibliothek - 44 Bücher, die man gelesen haben muss
Alle guten Worte stehen in Büchern, sagt ein chinesisches Sprichwort. Aber in welchen? Welche Bücher tragen zur Vermehrung unseres Wissens bei, welche sind überflüssig? Welche Bücher unterhalten und belehren, welche hingegen vertreiben nur die Langeweile oder rauben uns sogar die Zeit? Ist es zweckmäßig und sinnvoll, einen Kanon unentbehrlicher Schriften aufzustellen? Der Autor meint: ja. (aus dem Klappentext)
Im Gegensatz zu Fritz J. Raddatz scheut Karl Hugo Pruys also nicht davor zurück seine Bestenliste als Kanon zu bezeichnen, schließlich handelt es sich hier nicht um Bücher, die man gelesen haben kann, sondern um solche, die man gelesen haben muss... um sich selbst und die Welt zu verstehen (Pruys im Vorwort). Folglich empfiehlt er uns nicht nur Werke der erzählenden Literatur. Neben den Psalmen, Empedokles, Seneca, Machiavelli und Pascal kommen vor: Voltaire, Sterne Montesquieu, Rousseau, Baudelaire, aber auch: Heine, Goethe, Stendhal, Flaubert, Gontscharow, Dostojewski, Wilde, Thomas Mann, Golo Mann, Hesse, Nabokov, Freud, Proust, Orwell und viele andere.
Die 44 Kapitel sind je 6 bis 8 Seiten lang. In den meisten Fällen enthalten sie Lesebeispiele der behandelten Texte. Am Schluß eines jeden Kapitels ist aufgeführt, in welchen Ausgaben die Bücher lieferbar sind. Neben einem ausführlichen Vorwort des Autors enthält das Buch im Anhang ein Glossar und zahlreiche Hinweise auf weiterführende Lektüre.
edition q in der Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin, 2001, 368 Seiten.
Marcel Reich-Ranicki: Der doppelte Boden
Hierbei handelt es sich um die Aufzeichnung zweier Gespräche, die Reich-Ranicki 1986 und 1991 mit dem Professor für Germanistik an der Universität Zürich Peter von Matt geführt hat. Im Plauderton geht es quer durch die deutschsprachige Literatur des  20. Jahrhunderts. Dabei dreht sich das Gespräch ausschließlich um Literatur, um die Arbeit des Kritikers, um Bücher und Autoren, Strömungen und Positionen. Dass sich der berühmte Germanist aus der Schweiz nicht mit der Rolle des Stichwortgebers für seinen noch berühmteren deutschen Kollegen begnügt und eigene Einsichten und Wertungen darlegt, liest sich gut im Klappentext, versteht sich jedoch von selbst. Schade nur, dass das Gespräch letztlich doch oberflächlich bleibt, aber dafür ist wohl die Fülle des Stoffs zu groß... oder das Buch zu dünn.
20. Jahrhunderts. Dabei dreht sich das Gespräch ausschließlich um Literatur, um die Arbeit des Kritikers, um Bücher und Autoren, Strömungen und Positionen. Dass sich der berühmte Germanist aus der Schweiz nicht mit der Rolle des Stichwortgebers für seinen noch berühmteren deutschen Kollegen begnügt und eigene Einsichten und Wertungen darlegt, liest sich gut im Klappentext, versteht sich jedoch von selbst. Schade nur, dass das Gespräch letztlich doch oberflächlich bleibt, aber dafür ist wohl die Fülle des Stoffs zu groß... oder das Buch zu dünn.
DER DOPPELTE BODEN ist ein sanftes, stilles Buch, fast ein überflüssiges, möchte ich meinen, aber dennoch ist es eines mit Charme, denn es macht Lust auf mehr. Es enthält eine Fülle von Anregungen, sich mit dem einen oder anderen weniger bekannten oder gar vergessenen Autor erneut zu beschäftigen. Und wenn ein Buch solches leisten kann, dann haben wir es im wahrsten Sinne des Wortes mit einem wertvollen Buch zu tun.
Zum Inhalt: Zwischen A wie Achternbusch und Z wie Zweig sind im Register mehr als 300 Autorennamen angegeben. Deshalb ist es müßig, hier eine Auswahl anzugeben.
Ammann Verlag AG, Zürich, 1992, 236 Seiten, 18,90 Euro.
Marcel Reich-Ranicki: Lauter Verrisse und Lauter Lobreden
Die beiden Bände vereinen Veröffentlichungen und öffentliche Vorträge Reich-Ranickis aus den Jahren 1966 bis 1984.
Lauter Verrisse: Anna Seghers, Hans Erich Nossak, Stefan Andres, Günter Eich, Friedrich Torberg, Rudolf Hagelstange, Stefan Heym, Alfred Andersch, Peter Weiss, Dieter Wellershoff, Martin Walser, Günter Grass, Günter Kunert, Reinhard Lettau, Horst Bienek, Thomas Bernhard, Günter Herburger, Peter Härtling, Adolf Muschg, Hubert Fichte, Peter Bichsel, Helga, M. Novak, Peter Handke und Hans Magnus Enzensberger.
Lauter Lobreden: Ricarda Huch, Hermann Kesten, Marie Luise Kaschnitz, Wolfgang Koeppen, Hans Werner Richter, Friedrich Luft, Hilde Spiel, Heinrich Böll, Horst Krüger, Friedrich Dürrenmatt, Peter Demetz, Walter Jens, Martin Walser, Günter Kunert, Peter Rühmkorf, Hans Joachim Schädlich, Karin Reschke und Hermann Burger.
Von Nutzen sind die beiden Bücher Reich-Ranickis nur dann, wenn man die von ihm zitierten AutorenInnen und deren Werke genau kennt. Wenn nicht, sind die beiden Bände wenig erbaulich und für einen gemütlichen Abend am Kamin denkbar ungeeignet. Dann bleiben sie was sie sind, im Sinne unserer Kapitelüberschrift: Sekundärliteratur.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 203 bzw. 207 Seiten, je 8,50 Euro
Marcel Reich-Ranicki: Lauter schwierige Patienten (Gespräche mit Peter Voß über Schriftsteller des 20. Jahrhunderts
Bücher mit, von und über Marcel Reich-Ranicki lassen sich immer gut verkaufen. Das dachte sich wohl auch der Südwestrundfunk, als er der Sendereihe ”Lauter schwierige Patienten” 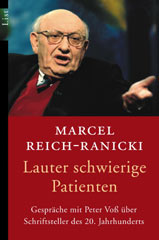 nun das Buch zum Film folgen ließ.
nun das Buch zum Film folgen ließ.
In LAUTER SCHWIERIGE PATIENTEN porträtierte Marcel Reich-Ranicki im Gespräch mit dem SWR-Intendanten Peter Voß 12 Persönlichkeiten der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, denen er persönlich begegnet ist: Bertolt Brecht, Erich Kästner, Anna Sehers, Elias Canetti, Wolfgang Koeppen, Hans Werner Richter, Golo Mann, Max Frisch, Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard.
Tatsächlich ist das Buch die wortwörtliche Wiedergabe dieser Gespräche `mit allen ihren Schwächen, also Wiederholungen, Flüchtigkeiten, gelegentlichen Versprechern und Irrtümer und... auch mit allen ihren Vorzügen´. Wer die Sendungen verpasst hat, kann hier also noch mal nachlesen - ein angenehmer, aber auch entbehrlicher Zeitvertreib. / List-Verlag, 2003, Taschenbuch, 304 Seiten, 8,95 Euro
Marcel Reich-Ranicki: Sieben Wegbereiter
Die Wegbereiter sind: Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Alfred Döblin, Robert Musil, Franz Kafka, Kurt Tucholsky und Bertolt Brecht.
Da die sieben Kapitel dieses Buches nicht als chronologische Biographien angelegt sind, werden einige Vorkenntnisse über Leben und Werk der Autoren vorausgesetzt. Mit Hilfe von Briefen, Tagebucheintragungen, Anekdoten oder Passagen aus ihren Werken analysiert und vergleicht Reich-Ranicki seine Wegbereiter und erklärt, warum für ihn aus Wegbereitern Wegbegleiter wurden.
Für den interessierten Literaten sicherlich lohnenswert - ich fand die Lektüre gelegentlich anstrengend und ermüdend.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart München 2002, geb., 300 Seiten, 19,90 Euro
Marcel Reich-Ranicki: Meine Geschichte der deutschen Literatur, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart und Meine deutsche Literatur seit 1945 Der Autor und Literaturkritker Marcel Reich-Ranicki war Zeit seines langen Lebens sehr produktiv. Er schrieb Bücher, hielt Vorträge und Reden, war Mitglied der Gruppe 47 und der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises und leitete das Literarische Quartett im ZDF. Vor allen Dingen aber trat er hervor als fachkundiger Essayist und scharfzüngiger Kritiker in den Literaturbeilagen namhafter Zeitungen wie der ZEIT und der FAZ. Da wunderte man sich nicht, als kurz nach
Der Autor und Literaturkritker Marcel Reich-Ranicki war Zeit seines langen Lebens sehr produktiv. Er schrieb Bücher, hielt Vorträge und Reden, war Mitglied der Gruppe 47 und der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises und leitete das Literarische Quartett im ZDF. Vor allen Dingen aber trat er hervor als fachkundiger Essayist und scharfzüngiger Kritiker in den Literaturbeilagen namhafter Zeitungen wie der ZEIT und der FAZ. Da wunderte man sich nicht, als kurz nach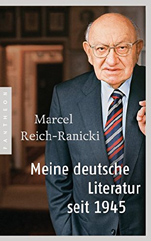 dem Tod MRRs im Jahr 2013 der Wunsch aufkam, seine wichtigsten Veröffentlichungen in einem Buch zu versammeln. Der Literaturwissenschaftler Thomas Anz hat dies im Auftrag des Pantheon-Verlags getan. Herausgekommen sind dabei gleich zwei Bücher: Im ersten Band widmet sich Anz den Veröffentlichungen Reich-Ranickis, die sich der Literatur vom Mittelalter bis zur Romantik widmen, dann dem Vormärz und dem Realismus, der literarischen Moderne bis 1945 und der Nachkriegsliteratur bis zur Gegenwart. Da diese Zeit eindeutig zum Schwerpunkt des literarischen Schaffens Reich-Ranickis gehörte, widmet sich der zweite Band ausschließlich der deutschen Literatur nach 1945. Versammelt sind in beiden Büchern ausnahmslos Essays und Kritiken, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bereits an anderer Stelle erschienen sind. Durch die chronologische Anordnung (im ersten Band nach den Geburtsdaten der Autoren/innen, im zweiten nach dem Datum der Veröffentlichung durch Reich-Ranicki) ergibt sich jedoch ein interessanter und lehrreicher Streifzug durch die deutschsprachige Literatur. Ein Nachschlagewerk also, auch ein Zeitdokument, nicht aber, um in einem Rutsch von vorn bis hinten durchgelesen zu werden. Also auch hier wieder: Bücher zum Stöbern und Querlesen.
dem Tod MRRs im Jahr 2013 der Wunsch aufkam, seine wichtigsten Veröffentlichungen in einem Buch zu versammeln. Der Literaturwissenschaftler Thomas Anz hat dies im Auftrag des Pantheon-Verlags getan. Herausgekommen sind dabei gleich zwei Bücher: Im ersten Band widmet sich Anz den Veröffentlichungen Reich-Ranickis, die sich der Literatur vom Mittelalter bis zur Romantik widmen, dann dem Vormärz und dem Realismus, der literarischen Moderne bis 1945 und der Nachkriegsliteratur bis zur Gegenwart. Da diese Zeit eindeutig zum Schwerpunkt des literarischen Schaffens Reich-Ranickis gehörte, widmet sich der zweite Band ausschließlich der deutschen Literatur nach 1945. Versammelt sind in beiden Büchern ausnahmslos Essays und Kritiken, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bereits an anderer Stelle erschienen sind. Durch die chronologische Anordnung (im ersten Band nach den Geburtsdaten der Autoren/innen, im zweiten nach dem Datum der Veröffentlichung durch Reich-Ranicki) ergibt sich jedoch ein interessanter und lehrreicher Streifzug durch die deutschsprachige Literatur. Ein Nachschlagewerk also, auch ein Zeitdokument, nicht aber, um in einem Rutsch von vorn bis hinten durchgelesen zu werden. Also auch hier wieder: Bücher zum Stöbern und Querlesen.
Band 1: Deutsche Verlags-Anstalt, München 2016, TB, 575 Seiten, 16,99 Euro
Band 2: Deutsche Verlags-Anstalt, München 2017, TB, 570 Seiten, 16,99 Euro
(beide Bände sind auch als gebundene Ausgaben erhältlich, jeweils 26,99 Euro)
Toni Richter: Die Gruppe 47 in Bildern und Texten
An dieser Stelle ein ganz besonderer Tipp, so schön beiseit.
Hans Werner Richter, Kopf und Motor der Gruppe 47, schenkte seiner Frau Toni 1956 eine Pentacon-Kamera. Fortan trat sie als fotografierender `Störfaktor´ bei den Tagungen der Gruppe 47 auf. Diese und andere Fotos sind wesentlicher Bestandteil ihres Buches, aber nicht der einzige. Hinzu kommen Texte in Form von Kritiken, Eindrücken, Beschreibungen, Auszüge aus Tagebüchern, Gedichten usw.
Auf den Fotos sind sie alle versammelt, die Crème de la Crème der deutschsprachigen (Nachkriegs-) Literatur: Heinrich Böll, Alfred Andersch, Wolfgang Hildesheimer, Ilse Eichinger, Martin Walser, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Koeppen, Jürgen Becker, Alexander Kluge, Günter Eich, Walter Höllerer, Wolfdietrich Schnurre, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Dieter Wellershoff, Walter Jens, Uwe Johnson, Siegfried Lenz, Peter Rühmkorf, Erich Fried, Gabriele Wohmann, Nicolas Born, Peter Handke, und auch Marcel Reich-Ranicki, Siegfried Unseld, Klaus Wagenbach, Hellmuth Karasek, Fritz J. Raddatz und viele, viele andere.
Dieses ist ein Buch für den gemütlichen Winterabend am Kamin. Ein Buch zum Lesen, Blättern, Schauen, zum Träumen und Erinnern. Allen Träumern empfohlen.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1997, 224 Seiten
Annemarie und Wolfgang van Rinsum:
Lexikon literarischer Gestalten, deutschsprachige Literatur und
Lexikon literarischer Gestalten, fremdsprachige Literatur
Welche Fleißarbeit das Autorenehepaar bei der Niederschrift der beiden Bücher geleistet haben muß, ist kaum zu ermessen. 3.000 Artikel enthält der eine, 4.000 der andere Band. Bei einer solchen Fülle darf man eine tiefergehende Charakterisierung der Figuren daher nicht erwarten. Die einzelnen Artikel beschränken sich auf wenige Grundinformationen. Sie weisen zunächst Werk und Autor nach und geben dann in einfacher, plastischer Sprache Kurzinformationen über psychologische Anlage, Rolle im Textzusammenhang und literarhistorische Einordnung der jeweiligen Gestalt. Das Nachschlagewerk erfasst Gestalten aus der Literatur des Mittelalters bis in die Gegenwart. Die neuere Gegenwartsliteratur (der 1990er Jahre) ist nicht vertreten. Die Eintragungen reichen bis in die Mitte der 1980er Jahre. Sten Nadolny, Louis Begley und Paul Auster beispielsweise sind nicht mehr vertreten, auch nicht Bodo Kirchhoff und Günter Grass mit EIN WEITES FELD, dafür aber Patrik Süskind mit seinem Antihelden Grenouille aus DAS PARFÜM und Umberto Eco mit William von Baskerville aus DER NAME DER ROSE. Sehr hilfreich ist das Register im Anhang, das die im Buch besprochenen Autoren und Werke alphabetisch auflistet.
Fazit: ein durchaus nützliches Lexikon. Für tiefergehende Informationen sollte man jedoch weitere Nachschlagewerke hinzuziehen.
Alfred Kröner Verlag Stuttgart, 1993 / 1990, 531 / 676 Seiten, 20,50 Euro bzw. 22,50 Euro; Insel Verlag, Frankfurt am Main, 2003, Taschenbuch, 10 Euro
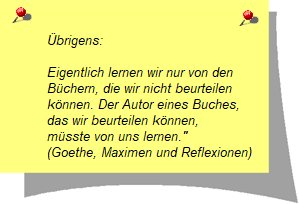 |
Georg Ruppelt: Buch- und Bibliotheksgeschichte(n)
Bücher und Bibliotheken sind Wunder - sie sind Wunder, weil sie auf kleinstem oder vergleichsweise kleinem Raum die Welt abbilden, wie sie ist, wie sie war und wie sie (möglicherweise) sein wird, aber auch wie sie sein sollte und wie sie sein könnte.
Georg Ruppelt, so scheint es, ist der Experte für Bibliothekswesen. Er ist Direktor der Niedersächsischen Landesbibliothek (Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek) und engagiert sich seit mehrt als drei Jahrzehnten in nationalen und internationalen bibliothekarischen und kulturpolitischen Gremien. Die Liste seiner Publikationen ist lang.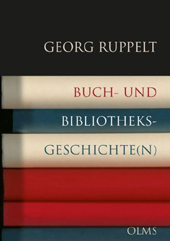
Im vorliegenden Band versammelt Ruppelt Texte, die in anderem Zusammenhang bereits an früherer Stelle erschienen sind. Aus dem Inhaltsverzeichnis: Von Bücherschändern, Bücherdieben und Verbrechen aus Leidenschaft; Merkwürdige Fälle aus der Zensurgeschichte; Reclams Universalbibliothek - von ihrer Gründung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts; Reclams Universalbibliothek im Dritten Reich; Tarnschriften gegen die NS-Diktatur; Bücher und Zeitungen in Deutschland 1945; Vom Anfang der Zeitung und von ihrem (prophezeiten) Ende; Marpergers “Vollständiges Küch- und Keller-Dictionarium” von 1716; Henriette Davidis und ihr berühmtes Kochbuch; Vom Vergnügen in alter Küchenliteratur zu lesen; Bibliotheksgeschichte im Überblick; Die deutschen Bibliotheken am Anfang des 21. Jahrhunderts.
Die einzelnen Kapitel nehmen wenig Bezug aufeinander und stehen recht isoliert da, vielleicht auch, weil sich der eine oder andere Text doch an ein spezielles Publikum wendet (Vollständiges Küch- und Keller-Dictionarium, Henriette Davidis, Küchenliteratur). Interessant dagegen die Kapitel über Tarnschriften, die Zeitungsgeschichte und die Bibliotheksgeschichte von der ersten Bibliothek im Alten Orient bis zur modernen multimedialen Bibliothek unserer Tage. Hochspannend sogar der Text über Bücherschänder, Bücherdiebe und Verbrecher aus Leidenschaft. Hier begegnen wir wieder unserem wunderlichen Freund Johann Georg Tinius. (siehe auch: Themen/ Bücher über Bücher)
Georg Olms Verlag, Hildesheim 2007, Paperback, 229 Seiten, 19,80 Euro
Rüdiger Safranski: KLASSIKER, ein Gespräch über die Literatur und das Leben mit Michael Krüger und Martin Meyer
Das Wort „Gespräch“ führt hier in die Irre. Glaubt man doch, alle drei Protagonisten hätten gleichen Anteil daran. Dem ist nicht so. Es spricht meistens nur einer. Michael Krüger und Martin Meyer dienen hauptsächlich als Fragesteller und geschickte Stichwortgeber. Der hier spricht ist Rüdiger Safranski. 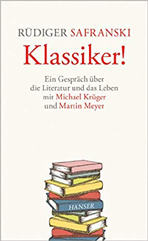 Um ihn geht es in diesem Buch. Um ihn, den Autor, Literaturwissenschaftler, den Philosophen. In der ersten Hälfte des Gesprächs, das an zwei Tagen im April 2019 im Carl Hanser Verlag in München stattfand, geht es um Safranskis Kindheit und Jugend, seine Studentenzeit in Frankfurt und Berlin. Wir erfahren, was er gelesen, was ihn beeinflusst hat, wie er wurde, was er ist: einer der führenden Intellektuellen dieses Landes, Autor von mehr als 15 Büchern, darunter seine bekanntesten, die Biographien von E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Heidegger, Goethe und Schiller, Nietzsche und Hölderlin. In der zweiten Hälfte des Buches tauchen wir dann ein in den Safranski-Kosmos. Da geht es dann ausschließlich um Literatur, Weltanschauung, Kanondebatte, deutsche Schicksale, deutsche Kultur und auch darum: Wie schreibt man eine Biographie? Einen Rundumschlag, der alle Klassiker der deutschen Literaturgeschichte streift, sollte man dabei nicht erwarten. Nur selten wird die Grenze des Safranski-Territoriums überschritten.
Um ihn geht es in diesem Buch. Um ihn, den Autor, Literaturwissenschaftler, den Philosophen. In der ersten Hälfte des Gesprächs, das an zwei Tagen im April 2019 im Carl Hanser Verlag in München stattfand, geht es um Safranskis Kindheit und Jugend, seine Studentenzeit in Frankfurt und Berlin. Wir erfahren, was er gelesen, was ihn beeinflusst hat, wie er wurde, was er ist: einer der führenden Intellektuellen dieses Landes, Autor von mehr als 15 Büchern, darunter seine bekanntesten, die Biographien von E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Heidegger, Goethe und Schiller, Nietzsche und Hölderlin. In der zweiten Hälfte des Buches tauchen wir dann ein in den Safranski-Kosmos. Da geht es dann ausschließlich um Literatur, Weltanschauung, Kanondebatte, deutsche Schicksale, deutsche Kultur und auch darum: Wie schreibt man eine Biographie? Einen Rundumschlag, der alle Klassiker der deutschen Literaturgeschichte streift, sollte man dabei nicht erwarten. Nur selten wird die Grenze des Safranski-Territoriums überschritten.
Das ist stellenweise ermüdend, manchmal auch überfordernd. Dann nämlich, wenn man den dreien auf ihren intellektuellen Höhenflügen nicht mehr folgen kann und einem der Kopf rauscht. Meistens ist es jedoch ein Vergnügen, diesem geistreichen Gespräch zu folgen, so vergnüglich wie ein abendliches Kamingespräch mit einem guten Freund.
Carl Hanser Verlag, München 2019, 157 Seiten, geb., 18 Euro
Frank Schäfer:
Kultbücher, Von ´Schatzinsel´ bis `Pooh´s Corner´ - eine Auswahl
51 Titel hat Frank Schäfer hier versammelt. Haben wir es nun mit einem Kanon zu tun? Nein, meint der Autor, eher versteht er seine Bücherliste als Systematisierungsangebot(?), allenfalls als Versuch einer alternativen Kanonbildung. So muss die Auswahl verständlicherweise subjektiv sein, denn die acht im Vorwort erwähnten Kriterien, die ein Kultbuch auszeichnen, treffen auch auf viele andere Bücher zu. Im Nachwort sind einige davon aufgeführt und bereiten dem Autor berechtigterweise ein schlechtes Gewissen. Stehen die wirklichen Kultbücher also eher im Nachwort als im Hauptteil des Buches, habe ich mich gefragt und war gleich geneigt Ernst Jüngers STAHLGEWITTER gegen Hesses STEPPENWOLF und DIE FACKEL von Karl Kraus gegen Bulgakows DER MEISTER UND MARGARITA auszutauschen. PU, DER BÄR dagegen hat es gut, er ist dank seines Erfinders A. A. Milne und des Kultstatus Harry Rowohlts gleich zweimal vertreten.
Dennoch: die Idee eines alternativen Kanons gefällt mir und die drei- bis vierseitigen Beiträge sind witzig und intelligent. Trotzdem erscheint mir der Preis für die Paperbackausgabe doch ein wenig zu hoch.
Noch ein paar Titel aus dem Inhaltsverzeichnis: Winnetou (Karl May), Die Tigerin (Walter Serner), Glastonbury Romance (John Cowper Powys), Finnegans Wake (James Joyce), Der Herr der Ringe (J.R.R. Tolkien), The Naked Lunch (William S. Burroughs), Die Palette (Hubert Fichte), Sex Front (Günter Amendt), Trilogie des laufenden Schwachsinns (Eckehard Henscheid), Die Reise (Bernward Vesper), Meine Fresse (Uli Becker), Rom, Blicke (Rolf Dieter Brinkmann), Irre (Reinald Goetz), Unter Null (Brett Easton Ellis), Generation X (Douglas Coupland) ...
Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin, 2000; Paperback, 270 Seiten; 15,90 Euro
Denis Scheck: Schecks Kanon - Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur,
von “Krieg und Frieden” bis “Tim und Struppi”
Einen ganz außergewöhnlichen Literaturkanon hat der Kritiker Denis Scheck zusammengestellt. Er nennt ihn einen “wilden” Kanon. Wild daran ist die Auswahl der Bücher und AutorInnen. “Mein Kanon ist nicht auf die deutschsprachige Literatur beschränkt,” sagte Denis Scheck 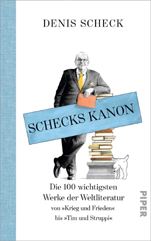 zu Anfang. “Er kommt an die Gegenwart, ist natürlich auch offen für Genre-Erfahrungen. Da wird Science Fiction, Fantasy, Krimi eine Rolle spielen, sogar Comics. Ich möchte einen Kanon fürs 21. Jahrhundert machen, wo die Globalisierung und die Vernetzung unseres Lebens über die sozialen Netzwerke, übers Internet natürlich eine andere Sichtweise auf Literatur ergeben,” Und so stehen auf der List der wichtigsten Meisterwerke der Weltliteratur nicht nur Namen wie Vergil, Tostoi, Kafka, Goethe, Dostojewski und Proust sondern auch Titel wie Frankenstein, Der Herr der Ringe und Tim und Struppi neben AutorInnen wie Astrid Lindgren, Carl Barks (Donald Duck), Charles M. Schulz (Peanuts), Agatha Christie und die Brüder Grimm.
zu Anfang. “Er kommt an die Gegenwart, ist natürlich auch offen für Genre-Erfahrungen. Da wird Science Fiction, Fantasy, Krimi eine Rolle spielen, sogar Comics. Ich möchte einen Kanon fürs 21. Jahrhundert machen, wo die Globalisierung und die Vernetzung unseres Lebens über die sozialen Netzwerke, übers Internet natürlich eine andere Sichtweise auf Literatur ergeben,” Und so stehen auf der List der wichtigsten Meisterwerke der Weltliteratur nicht nur Namen wie Vergil, Tostoi, Kafka, Goethe, Dostojewski und Proust sondern auch Titel wie Frankenstein, Der Herr der Ringe und Tim und Struppi neben AutorInnen wie Astrid Lindgren, Carl Barks (Donald Duck), Charles M. Schulz (Peanuts), Agatha Christie und die Brüder Grimm.
Die 100 Kapitel sind jeweils drei bis vier Seiten lang. Dabei läßt Denis Scheck den Leser durchaus auch an seinen persönlichen Leseerfahrungen teilhaben. Ein kluges und vergnügliches Buch, auch wenn mir der Preis von 25 Euro doch ein wenig hoch erscheint. Vielleicht wäre eine preiswerte Paperback-Ausgabe sinnvoller gewesen.
Piper Verlag, München 2019, Hln 25,00 Euro, mit 25 Schwarz-Weiß-Illustrationen von Torben Kuhlmann
Denis Schecks Kanon ist auch als Podcast bei WDR 5 zu hören und als Video beim SWR zu sehen.
Heinz Schlaffer: Die kurze Geschichte der deutschen Literatur
Nimmt man das schmale Buch von Heinz Schlaffer zur Hand, fallen gleich zwei Dinge positiv auf. Erstens: Es ist wirklich dünn - nur 158 überschaubare Seiten wirken einladend. Zweitens: Es kommt völlig ohne Randbemerkungen, Fußnoten, Begriffserklärungen und Anhang aus - wir haben also kein abschreckendes, wissenschaftliches Werk vor uns, sondern eine leicht lesbare Lektüre. Schlaffer beweist eindrucksvoll, dass die deutsche Literatur tatsächlich keine lange Tradition besitzt. Nach einer langen, diffusen Vorgeschichte folgte der erste Höhepunkt von ca. 1770 bis 1830 um nach einem durchwachsenen Auf und Ab eine weitere Glanzzeit zu erleben, von 1900 bis 1950. Nichts Nennenswertes also in unserer Gegenwart? Schlaffer meint: Nein. Oder doch? Wird die Nachwelt vielleicht irgendwann einmal die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts als den Beginn eines neuen Höhepunktes der deutschsprachigen Literatur bezeichnen? Wohl kaum. (Was würden wohl die Redakteure des FASZ-Feuilletons dazu sagen? - siehe oben). Apropos deutsch, im Vorwort (nennen wir es einmal so) stellt Schlaffer die Frage, was ist das typische an der deutschsprachigen Literatur, durch welche Merkmale unterscheidet sie sich von den Literaturen anderer Länder und Sprachen, woran liegt es, dass die Werke Goethes, Jean Pauls und Novalis‘ in englischer Version für ein englisches Publikum nicht ihre Fremdheit verlieren? Die Antwort ist verblüffend: Es ist die Religiosität.
Wie ich finde, lohnt sich der Kauf des Buches schon allein wegen dieses Kapitels. Für den durchschnittlich interessierten Leser gewinnt hingegen der Hauptteil des Buches naturgemäß an Spannung, je mehr sich der Autor den bekannten Größen der Literatur zuwendet.
Das Inhaltsverzeichnis: Deutsch; Missglückte Anfänge (das verschollene Mittelalter, die verspätete Neuzeit); Der glückliche Anfang (Pfarrersöhne Musensöhne, die neue Sprache, die unsterbliche Poesie); Fortgang, Wiederkehr und Ende (Fortgang: das 19. Jahrhundert, Wiederkehr und Ende: das 20. Jahrhundert); Geschichte der Literatur
C. Hanser Verlag, München 2002, 12,90 Euro
Rainer Schmitz: Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, Was Sie über Literatur nicht wissen
Nach Dietrich Schwanitz’ BILDUNG - ALLES, WAS MAN WISSEN MUSS und CHRISTIANE ZSCHIRNTs BÜCHER - ALLES, WAS MAN LESEN MUSS legt der Eichborn Verlag nun den dritten Band aus der Reihe Allgemeinbildung und Literatur vor. Und der hat es in sich. Mit über 900 engbedruckten Seiten ist es das schwerste und dickste Buch von allen. Nach eigenem Bekunden hat Rainer Schmitz mehr als 20 Jahre lang für sein Lexikon recherchiert, gesammelt und notiert. Herausgekommen ist ein Kompedium mit 1.200 Stichwörtern und fast 4.000 Namen - ein Füllhorn an interessanten Hintergrundinformationen, wissenswerten Nebensächlichkeiten, witzigen Anekdoten und skurrilen Begebenheiten aus dem Bereich der Literatur, von denen in herkömmlichen 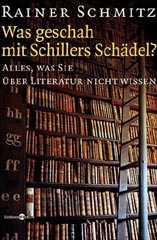 Literaturlexika gewöhnlich nichts zu finden ist. Wir erfahren (Klappentext) ...was mit Schillers Schädel geschah, wo die Asche Dantes sich befindet (...), wie Edgar Allan Poe zu Tode kam, welche Werke außer Cervantes’ DON QUIXOTE und Marco Polos WUNDER DER WELT noch im Gefängnis geschrieben wurden, welche Autoren die besten und welche die schlechtesten Verträge hatten, welches die teuersten literarischen Manuskripte sind, die versteigert wurden (und zu welchem Preis), wer die produktivsten und wer die faulsten Literaten waren, wer alles von der Syphilis heimgesucht wurde, wer welche Testamente hinterließ und wer alles an Zyankali starb. Das alles ist unglaublich spannend zu lesen. Vor allem das weitverzweigte Verweisungssystem mit tausenden von Querverweisen zieht den Leser immer weiter in die Texte hinein. Tatsächlich, hat man mit dem Schmökern einmal angefangen, kann man das Buch schwerlich wieder aus der Hand legen. Trotzdem, ob man das Buch einmal als den Schmitz (wie der Verlag im Klappentext prognostiziert) bezeichnen wird, ist fraglich. Denn als Nachschlagewerk zur gezielten Recherche halte ich es für weniger geeignet. Wer unter den Stichwörtern nicht fündig wird, muss nämlich auf das Namensverzeichnis ausweichen und da hier nur Seitenangaben nicht aber die entsprechenden Kapitelüberschriften zu finden sind, kann die Recherche schnell in mühevolles Durchblättern und nervendes Querlesen ausarten. Ein Beispiel: Mich interessierte, was Rainer Schmitz zu Dostojewskis Beinahe-Hinrichtung im Jahre 1842 zu sagen hat. Doch im Buch findet man weder die Stichworte Hinrichtung und Exekution noch Scheinhinrichtung, Erschießung und Begnadigung. Im Namensverzeichnis unter Dostojewski sind jedoch 14 Seitenzahlen aufgeführt. Sie verweisen auf die Kapitel Bärte, Epilepsie, Fuß, Gefängniserfahrungen, Glücksspiel, Hämorrhoiden, Kanon, Lunge, Pädophilie, Plagiat, längste Romane, Roulette und geänderte Titel. Zum Schluss fand ich den gesuchten Beitrag unter ‘T’ wie Todesurteil. (Übrigens, unter Glücksspiel und Roulette fanden sich teilweise identische Texte zu Dostojewskis Spielsucht.) Doch dies soll Rainer Schmitz’ Leistung auf keinen Fall schmälern, denn WAS GESCHAH MIT SCHILLERS SCHÄDEL? gehört tatsächlich auf jeden Nachttisch und richtig ist auch: Dies ist ein Buch, das sich niemals auslesen lässt.
Literaturlexika gewöhnlich nichts zu finden ist. Wir erfahren (Klappentext) ...was mit Schillers Schädel geschah, wo die Asche Dantes sich befindet (...), wie Edgar Allan Poe zu Tode kam, welche Werke außer Cervantes’ DON QUIXOTE und Marco Polos WUNDER DER WELT noch im Gefängnis geschrieben wurden, welche Autoren die besten und welche die schlechtesten Verträge hatten, welches die teuersten literarischen Manuskripte sind, die versteigert wurden (und zu welchem Preis), wer die produktivsten und wer die faulsten Literaten waren, wer alles von der Syphilis heimgesucht wurde, wer welche Testamente hinterließ und wer alles an Zyankali starb. Das alles ist unglaublich spannend zu lesen. Vor allem das weitverzweigte Verweisungssystem mit tausenden von Querverweisen zieht den Leser immer weiter in die Texte hinein. Tatsächlich, hat man mit dem Schmökern einmal angefangen, kann man das Buch schwerlich wieder aus der Hand legen. Trotzdem, ob man das Buch einmal als den Schmitz (wie der Verlag im Klappentext prognostiziert) bezeichnen wird, ist fraglich. Denn als Nachschlagewerk zur gezielten Recherche halte ich es für weniger geeignet. Wer unter den Stichwörtern nicht fündig wird, muss nämlich auf das Namensverzeichnis ausweichen und da hier nur Seitenangaben nicht aber die entsprechenden Kapitelüberschriften zu finden sind, kann die Recherche schnell in mühevolles Durchblättern und nervendes Querlesen ausarten. Ein Beispiel: Mich interessierte, was Rainer Schmitz zu Dostojewskis Beinahe-Hinrichtung im Jahre 1842 zu sagen hat. Doch im Buch findet man weder die Stichworte Hinrichtung und Exekution noch Scheinhinrichtung, Erschießung und Begnadigung. Im Namensverzeichnis unter Dostojewski sind jedoch 14 Seitenzahlen aufgeführt. Sie verweisen auf die Kapitel Bärte, Epilepsie, Fuß, Gefängniserfahrungen, Glücksspiel, Hämorrhoiden, Kanon, Lunge, Pädophilie, Plagiat, längste Romane, Roulette und geänderte Titel. Zum Schluss fand ich den gesuchten Beitrag unter ‘T’ wie Todesurteil. (Übrigens, unter Glücksspiel und Roulette fanden sich teilweise identische Texte zu Dostojewskis Spielsucht.) Doch dies soll Rainer Schmitz’ Leistung auf keinen Fall schmälern, denn WAS GESCHAH MIT SCHILLERS SCHÄDEL? gehört tatsächlich auf jeden Nachttisch und richtig ist auch: Dies ist ein Buch, das sich niemals auslesen lässt.
Eichborn Verlag AG, Frankfurt am Main, 2006; gebunden, 920 zweispaltige Seiten, 39,90 Euro; www.eichborn-verlag.de
![]()
Margit Schönberger, Karl Heinz Bittel: Die glückliche Leserin,
100 Romane für alle Lebenslagen
Sie leiden an Lebensüberdruss und Langeweile? Sie haben Ihr Talent überschätzt? Sie fühlen sich von Ihrer Umwelt manipuliert? Dann ist das Buch von Margit Schönberger und Karl Heinz Bittel genau das richtige für Sie. Für jede Situation gibt’s hier den passenden Roman: 100 Romane für (fast) alle Lebenslagen, denn Romane bieten Trost und Rat, ja, sie vermögen sogar glücklich zu machen. Man muss sie nur lesen diese Bücher, denn in unserer Romanliteratur ist alles versammelt, was das Leben an Nöten, Kränkungen, Konflikten, Ängsten, Seelen- und Weltschmerzen für uns bereit hält. Eine schöne Idee: die Literatur als Mittel der Homöopathie. Also, wenn Sie Ihren Job verloren haben und vor den Trümmern Ihrer Existenz stehen, dann lesen Sie: George Simenon, Der Mann, der den Zügen nachsah; oder wenn Sie überzeugter Pazifist sind, sich aber zunehmend auf verlorenem Posten fühlen, dann greifen Sie zu Norman Mailer, Die Nackten und die Toten; oder Sie leiden unter der Gleichförmigkeit Ihres Lebens und sehnen sich nach mehr Freiheit, dann mag Ihnen vielleicht Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas helfen; oder Sie haben das Gefühl, Ihnen fällt die Decke auf den Kopf, dann empfiehlt Ihnen das Autorenduo Jack Kerouac, Unterwegs. Jeder Artikel ist zwei bis drei Seiten lang, beginnt mit einer kurzen Analyse der betreffenden Lebenslage, beschreibt ausführlich Form und Inhalt des vorgeschlagenen Romans und schließt mit einem kurzen Fazit. Weitere Autoren sind: Arundhati Roy, Proust, Zola, Updike, Mankell, Kafka, Joan Aiken, Joanne K. Rowling, Cornelia Funke, Márquez, Kipling, Capote, Eco, Thomas Mann, Nabokov, Noah Gordon, Toni Morrison und viele andere. Warum sich das kurzweilige Buch allerdings ausdrücklich nicht an männliche Leser, sondern nur an Leserinnen wendet, bleibt schleierhaft. Dass nur Frauen Romane lesen, Männer aber überwiegend zu Sachbüchern greifen, wie die Autoren in ihrer Einleitung behaupten, scheint mir sehr platt zu sein.
Knaur Verlag, München, 2010; gebunden, 350 Seiten, 18 Euro
![]()
Wulf Segebrecht: Was sollen Germanisten lesen?
Noch eine Leseliste. An wen sie sich wendet sagt schon der Titel: an Germanisten (und alle, die es werden wollen). Dabei versteht Wulf Segebrecht seine Liste eher als Vorschlag, nicht als verbindlichen Kanon. Doch: Wer es sich allerdings zur Pflicht machen möchte, deutschsprachige Werke von zentraler literaturgeschichtlicher Bedeutung und hohem ästhetischen Anspruch zur Kenntnis zu nehmen, der findet in der vorliegenden Liste sicherlich vieles von dem, `was man gelesen haben muss´. (aus dem Vorwort)
Die Liste reicht chronologisch von den Anfängen der deutschen Literatur bis zur Gegenwart. Im Gegensatz zur o.g. Reclam-Leseliste verzichtet der Autor jedoch auf weiterführende Kommentierung; außerdem handelt sich hierbei ausschließlich um deutschsprachige Literatur, abgesehen von einem augenzwinkernden Protest gegen ihre Missachtung von Proust, Dickens, Dostojewskij und Co. auf den Seiten 34 und 35.
Mein Urteil: Durchaus verzichtbar, doch wer weniger an Einzelwerken als an Anthologien mit Lyrik, Erzählungen und Kurzgeschichten bestimmter Epochen interessiert ist, findet interessante Hinweise am Ende der jeweiligen Kapitel.
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2000; Taschenbuch; 84 Seiten; 7,80 Euro
Sempé: Für Bücherfreunde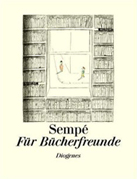 Eine Sammlung Cartoons mit denen der Zeichner Jean- Jacques Sempé uns Leser,, Büchersammler und Möchtegern-Autoren in äußerst humorvoller Weise mal so richtig aufs Korn nimmt. Eine augenzwinkernde Hommage an die kleine Welt der Eingeschworenen, die ohne Bücher nicht leben können - weil das Leben ohne das Leben nicht ausreicht. (Klappentext) Die Cartoons sind durchweg in schwarz-weiß und ganzseitig, teilweise auch mehrseitig. Ausgewählt von Daniel Kehl und Daniel Kampa.
Eine Sammlung Cartoons mit denen der Zeichner Jean- Jacques Sempé uns Leser,, Büchersammler und Möchtegern-Autoren in äußerst humorvoller Weise mal so richtig aufs Korn nimmt. Eine augenzwinkernde Hommage an die kleine Welt der Eingeschworenen, die ohne Bücher nicht leben können - weil das Leben ohne das Leben nicht ausreicht. (Klappentext) Die Cartoons sind durchweg in schwarz-weiß und ganzseitig, teilweise auch mehrseitig. Ausgewählt von Daniel Kehl und Daniel Kampa.
Diogenes Verlag, Zürich 2006; gebunden, 108 Seiten,
9,90 Euro
Barbara Sichtermann/ Joachim Scholl: 50 Klassiker - Romane vor 1900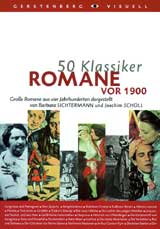 Aus dem Klappentext: 50 KLASSIKER, ROMANE VOR 1900 stellt bedeutende Romane von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert vor, die zum lesenswerten Kanon gehören. In jedem Kurzessay wird ein Roman vorgestellt, seine Bedeutung erläutert und seine Wirkung betrachtet. Zitate von Kritikern sowie Verrisse und Lobeshymnen werden durch Kästen hervorgehoben. Auf der Faktenseite finden sich die Biographie des jeweiligen Autors, seine wichtigsten Werke sowie Film-, Hör- und Leseempfehlungen. Abgerundet wird das Buch durch ein ausführliches Glossar sowie ein Personen- und Werkregister.
Aus dem Klappentext: 50 KLASSIKER, ROMANE VOR 1900 stellt bedeutende Romane von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert vor, die zum lesenswerten Kanon gehören. In jedem Kurzessay wird ein Roman vorgestellt, seine Bedeutung erläutert und seine Wirkung betrachtet. Zitate von Kritikern sowie Verrisse und Lobeshymnen werden durch Kästen hervorgehoben. Auf der Faktenseite finden sich die Biographie des jeweiligen Autors, seine wichtigsten Werke sowie Film-, Hör- und Leseempfehlungen. Abgerundet wird das Buch durch ein ausführliches Glossar sowie ein Personen- und Werkregister.
Genau so ist es. Flott aufgemacht und recht modern kommt das Buch daher, durchweg farbig angelegt, mit Standfotos aus den Verfilmungen der Romane, mit Abbildungen von zeitgenössischen Gemälden und den Covern der Erstausgaben. Den Autoren geht es nicht allein um Daten und Fakten, sondern vielmehr um das `Drumherum´, um die liebenswerten Nebensächlichkeiten und Anekdoten aus dem Leben der Schriftsteller und der Entstehungsgeschichte ihrer Werke. Ein kurzweiliges Nachschlagewerk also, in erster Linie unterhaltsam, auch für den, der ziellos blättert, um sich dann vielleicht doch in dem einen oder anderen der 50 Kapitel festzulesen.
Aus dem Inhalt: Rabelais, Cervantes, Defoe, Swift, Prévost, Fielding, Sterne, Goethe, Jean Paul, Jane Austen, Scott, Cooper, Manzoni, Hugo, Poe, Melville, Keller, Tolstoi, Eliot, Verne, Zola, Hamsun, Kipling, Fontane ...
Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 2002, 280 Seiten, 19,95 Euro
Joachim Scholl: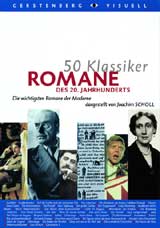 50 Klassiker - Romane des 20. Jahrhunderts
50 Klassiker - Romane des 20. Jahrhunderts
Was für die Romane des 19. Jahrhunderts gilt, das gilt auch für die des 20. Jahrhunderts. Vielleicht aber wird diese Ausgabe ein wenig mehr vom Mainstream getragen, denn neben Henry Miller, Jaroslav Hasek und D.H. Laurence kommen auch Michael Ende, John Irving, Patrick Süskind, Douglas Coupland und Astrid Lindgren vor. Hier noch ein paar andere Namen: Conrad, Proust, Svevo, Kafka, Woolf, Hesse, Faulkner, Canetti, Mitchell, Camus, Salinger, Sagan, Frisch, Updike, Lem, Burgess, Böll, Márquez, Jurek Becker, Johnson, Pynchon, Eco, Rushdie ...
Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 2001, 280 Seiten,
19,95 Euro
Barbara Sichtermann: 50 Klassiker - Schriftstellerinnen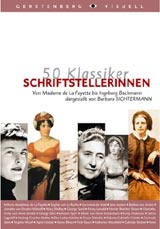 Der dritte Band der Reihe 50 KLASSIKER gleicht in Umfang und Ausstattung den beiden vorangegangenen. Hier allerdings geht es ausschließlich um SchriftstellerINNEN. Untertitel: Von Madame de La Fayette bis Ingeborg Bachmann. Weitere Namen sind Sophie von La Roche, Jane Austen, George Sand, Johanna Spyri, Grazia Deledda, Gertrude Stein, Karen Blixen, Gabriela Mistral, Anna Achmatowa, Marina Zwetajewa, Marguerite Yourcenar, Mascha Kaléko, Elsa Morante, Iris Murdoch, Sylvia Plath, Nathalie Sarraute und viele andere.
Der dritte Band der Reihe 50 KLASSIKER gleicht in Umfang und Ausstattung den beiden vorangegangenen. Hier allerdings geht es ausschließlich um SchriftstellerINNEN. Untertitel: Von Madame de La Fayette bis Ingeborg Bachmann. Weitere Namen sind Sophie von La Roche, Jane Austen, George Sand, Johanna Spyri, Grazia Deledda, Gertrude Stein, Karen Blixen, Gabriela Mistral, Anna Achmatowa, Marina Zwetajewa, Marguerite Yourcenar, Mascha Kaléko, Elsa Morante, Iris Murdoch, Sylvia Plath, Nathalie Sarraute und viele andere.
Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 2009, 272 Seiten,
19,95 Euro
Dietrich Schwanitz: Bildung: Alles, was man wissen muss
Über dieses Werk ist viel gesprochen und geschrieben worden. Dass Bildung einen wesentlichen Bestandteil unserer Kultur darstellt, ist wohl unbestritten. Trefflich streiten lässt sich aber darüber, was dieses alles denn nun genau beinhalten soll. Schwanitz ist dabei ein allzu subjektiver, oberflächlicher, gar zu flüchtiger Blick auf die Dinge vorgeworfen worden, besonders bei dem Kapitel Literatur. Rilke habe er schlichtweg vergessen, höre ich die Kritiker noch rufen. Ob mit oder ohne Rilke, jedenfalls lässt sich gut streiten über diesen Literaturkanon und, wenn Sie mich fragen, eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Thema kann eigentlich erst stattfinden, wenn man sich auf Augenhöhe mit dem Autor befindet, sprich: Schwanitz’ Bildungsniveau wenigstens annähernd selbst erreicht hat. Also, wer ohne Bildungslücken ist, werfe das erste Buch, pardon, den ersten Stein.
Zurück zum Buch. Wer nur an literarischer Bildung interessiert ist, lässt besser die Finger davon. Dafür ist das Buch zu teuer, denn nur etwa 70 der 540 Seiten befassen sich im engeren Sinne mit Literatur. Doch für alle die ihre allgemeine Bildung noch vertiefen wollen, ist es eine Investition. Es kommt nicht belehrend daher, ist leicht verständlich und sogar spannend zu lesen (besonders der geschichtliche Teil). Spannend ist die Lektüre auch deshalb, weil man ständig den Stand seiner eigenen Bildung - Pisa lässt grüßen - kontrollieren kann.
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1999, 540 Seiten, 26,00 Euro,
www.eichborn-verlag.de
DER SPIEGEL Nr. 25/2001
Einen wirklichen Literaturkanon finden wir in der Ausgabe 25 des Jahres 2001 im Magazin DER SPIEGEL unter der Überschrift: Literatur muss Spaß machen.
Und von wem stammt er? Natürlich wieder von Herrn M.R-R.
siehe: spiegel.de
DER SPIEGEL Nr. 42/2024
Nach DIE ZEIT hat auch DER SPIEGEL anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2024 einen weiteren Literaturkanon präsentiert: Die 100 besten Bücher von 1924 bis 2024. Von Der Zauberberg (Thomas Mann) bis zu Die Projektoren (Clemens Meyer). 100 deutschsprachige Prosawerke, eines für jedes Jahr? Nicht ganz. Der Jury war durchaus bewusst, dass es auch im literarischen Leben gute und schlechte Jahre gab. So sind die Vierzigerjahre gerade einmal mit vier AutorInnen vertreten (Anna Seghers, Ludwig Hohl, Hans Fallada, Ilse Eichinger), die Siebziger Jahre dagegen mit 14 (Johnson, Handke, Kempowski, Plenzdorf, Canetti, Lenz, Grass …), dem Jahrzehnt, das - laut SPIEGEL - im Zuge der bundesdeutschen Bildungsreform und des anwachsenden Taschenbuchmarkts ein erweitertes Lesepublikum erschlossen hat.
Die meisten Artikel umfassen nur wenige Sätze, knapp 20 Artikel erstrecken sich über eine halbe bis eine ganze Seite.
DER SPIEGEL Nr. 13/2025
Nach den 100 deutschsprachigen Prosawerken folgte anlässlich der Leipziger Buchmesse 2025 die Liste mit den internationalen Werken: Die 100 besten Bücher der Welt, 1925 bis 2025 - Der internationale Spiegel-Kanon. Es beginnt mit Mrs. Dalloway von Virginia Woolf und endet mit Der Kaiser der Freude von Ocean Vuong.
Der große SPIEGEL-Wissenstest Literatur (Martin Doerry und Volker Hage)
Wen liebte Goethes Faust?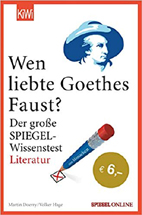 150 Fragen zur Literatur, jeweils zehn zu den Fachgebieten Weltliteratur, Theater, Lyrik, Krimi, Fantasy und Science-Fiction, Kinder- und Jugendbuch, Bestseller, Klassiker usw. 150 Fragen , jeweils vier Antworten, eine davon ist richtig. Wir kennen das Prinzip von den anderen Spiegel-Wissenstests. Am Ende gibt’s noch zwei Interviews mit den Geschwistern Eva und Robert Menasse und mit den Kritikern Volker Hage und Volker Weiderman. Kurzweilige Unterhaltung für eine Stunde, das war’s dann. Danach kann man das Buch weiterverschenken. Sechs Euro sind dafür nicht zuviel.
150 Fragen zur Literatur, jeweils zehn zu den Fachgebieten Weltliteratur, Theater, Lyrik, Krimi, Fantasy und Science-Fiction, Kinder- und Jugendbuch, Bestseller, Klassiker usw. 150 Fragen , jeweils vier Antworten, eine davon ist richtig. Wir kennen das Prinzip von den anderen Spiegel-Wissenstests. Am Ende gibt’s noch zwei Interviews mit den Geschwistern Eva und Robert Menasse und mit den Kritikern Volker Hage und Volker Weiderman. Kurzweilige Unterhaltung für eine Stunde, das war’s dann. Danach kann man das Buch weiterverschenken. Sechs Euro sind dafür nicht zuviel.
Verlag Kiepemheuer & Witsch, Köln 2018, TB, 192 Seiten, 6 Euro
Giorgio van Straten: Das Buch der verlorenen Bücher - Acht Meisterwerke und die Geschichte ihres Verschwindens
Acht Kapitel, acht offene Fragen - und viel Raum für Spekulation: Was befand sich in der schwarzen Ledertasche, die Walter Benjamin bei sich trug, als er auf seiner Flucht 1940 Selbstmord beging? Wer stahl 1922 in Paris den mit Manuskripten gefüllten Koffer Ernest Hemingways? Welche Schriften verbrannte Gogol 1852 im Kamin und was war so skandalös an den Erinnerungen Lord Byrons? Schlüssige Antworten hat auch der italienische Literaturwissenschaftler Giorgio van Straten nicht. Auch hat man das meiste schon - so oder ähnlich - in anderen Büchern gelesen. Trotzdem liest man seine, kurzen im lässigen Plauderton verfassten Texte mit Vergnügen. Wer es umfangreicher und tiefgründiger mag, dem sei ALEXANDER PECHMANN, DIE BIBLIOTHEK DER VERLORENEN BÜCHER (siehe oben) empfohlen.
Insel Verlag, Berlin 2017, 168 Seiten, 16 Euro
Rolf Vollmann: Der Roman-Navigator - Zweihundert Lieblingsromane von der `Blechtrommel´ bis `Tristram Shandy´
Wer kennt Rolf Vollmann nicht, diesen absoluten Leser, wie ihn die ZEIT kürzlich titulierte, der wahrscheinlich mehr Romane gelesen hat und kennt, als der normalsterbliche Leser auch in 200 Jahren niemals kennen lernen wird, der uns bekannt ist aus dem Radio mit seiner säuselnden Stimme und natürlich aus der Zeitung. Noch einmal die ZEIT: Hätte Vollmann einen eigenen Fernsehauftritt, er würde selbst unseren mäkligen Literaturpapst an Ruhm übertreffen, nicht, weil er der 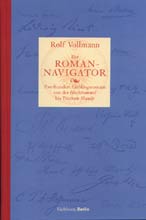 bessere Kritiker ist oder noch mal tausend Romane mehr gelesen hat als dieser, sondern weil er so wunderbar den Anschein erweckt, durch alle Bücher hindurch das Leben und die Menschen zu verstehen und auch aus dem apokryphsten Schmöker noch die zeitlose Botschaft für jedes fühlende Herz herausklopfen zu können.
bessere Kritiker ist oder noch mal tausend Romane mehr gelesen hat als dieser, sondern weil er so wunderbar den Anschein erweckt, durch alle Bücher hindurch das Leben und die Menschen zu verstehen und auch aus dem apokryphsten Schmöker noch die zeitlose Botschaft für jedes fühlende Herz herausklopfen zu können.
Aus einer Serie in der FAZ ist dieses Buch hervorgegangen. Auf 200 Seiten stellt es für die 200 Jahre zwischen 1959 und 1759 zweihundert Lieblingsromane vor. Es geht los mit der Blechtrommel und endet mit Tristram Shandy. Dazwischen keine ‘Nonames’, sondern allesamt Schwergewichte der Weltliteratur: Gadda, Nabokov, Bellow, Doderer, Hemingway, Kazantzakis, Simenon, Musil, Joyce, Beckett, die Manns, Miller, Döblin, Woolf, Svevo, Proust, Gide, Hamsun, Forster, Sologub, Bennett, Hesse, Raabe, Stevenson, Hardy, Loti, Zola, Flaubert, Jacobsen, Tolstoi, Turgenjew, Dostojewski, Dickens, Stifter, Keller, Melville, die Bronté-Schwestern, Gontscharow, Balzac, Lermontow, Poe, Goethe, Manzoni, Blicher, Puschkin, Cooper, Jean Paul, Lord Byron, Austen, Novalis, Tieck, Casanova, Wieland, de Sade, Bräker, Voss, Moritz, Choderlos de Laclos, Rousseau, Wezel, Voltair, Lavater, Diderot, Walpole usw.
Dieses Buch ist eine wirkliche Fundgrube, nicht zuletzt auch, weil der Autor es versteht seine Leser zu ‘umarmen’ und ihnen ein Appetithäppchen nach dem anderen anzubieten. Also: vor der Lektüre unbedingt Bleistift und Papier zurechtlegen - und das Telefon abschalten.
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1998; 240 Seiten; ca. 26 Euro (ev. auch im Modernen Antiquariat), www.eichborn-verlag.de
Rolf Vollmann: Die wunderbaren Falschmünzer - Ein Romanverführer
Das zweite Buch von Vollmann, das ich hier vorstellen möchte, erschien ein oder zwei Jahre vor dem Roman-Navigator. Mehr noch als dieser lässt es erahnen über welch gewaltiges Wissen der Autor verfügt. Aus dem Klappentext: Es sind rund 1.000 Romane aus allen europäischen und amerikanischen Literaturen und dreihundert Romanciers, die Vollmann uns in diesem Buch der Verführungen vorstellt. Romane, die ihm gefallen haben und von denen er glaubt, dass auch wir sie mit Lust und Liebe lesen werden, bringt er uns sehr nahe; bei anderen, die er für überschätzt hält, nimmt er kein Blatt vor den Mund. National-Literaturen und stilgeschichtliche Einteilungen spielen dabei keine Rolle für ihn. Er sieht die Romanzeit seit 1800 als ein einziges, grenzenloses Geniereich, in dem sich jeder, der Lust dazu hat, frei und unvoreingenommen bewegen kann.
Rolf Vollmann beschreibt die literarische Welt als einen einzigen, endlosen Roman. Die chronologische Abfolge zwingt den Autor jedoch ständig zwischen den Autoren/ Autorinnen und den Kulturen hin- und her zu springen. Das macht den tausendseitigen, mit vielen Fußnoten versehenen Text recht sperrig. Schließlich habe ich das Buch doch vorzeitig zurück ins Regal gestellt. Dort hat es jetzt seinen Platz - als Nachschlagewerk.
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main. 1997; 1080 Seiten; (ev. auch im Modernen Antiquariat), www.eichborn-verlag.de
Volltext - Zeitung für Literatur
Volltext gibt es seit Juli 2002 und auch Volltext kommt aus Österreich, aus Wien. Die Zeitschrift erscheint im Zeitungsformat. So lässt sich auch auf überschaubaren 32 Seiten eine Menge unterbringen. Neben der aufwändig aufgearbeiteten Titelgeschichte gibt es die üblichen Rubriken: Veranstaltungstermine, Promotion und Bücherschau. Erfreulicherweise wird bei der Vorstellung neuer Bücher auf langatmige Rezensionen verzichtet, zu Gunsten kurzer Zitate aus Buchkritiken überregionaler Tageszeitungen - eine gute Idee, bietet sie doch dem Leser die Möglichkeiten des schnellen Vergleichs. Dabei setzt VOLLTEXT aber nicht unbedingt auf Aktualität. Die Zeitschrift will vielmehr Autoren Raum geben, sie in Interviews vorstellen und Auszüge aus ihren Werken abdrucken. So haben die Seiten auch nicht die üblichen Überschriften wie Belletristik, Sachbuch, Reisen usw., sondern tragen konsequenter Weise gleich die Namen der Autoren um die es geht.
Unter www.volltext.at bekommt man Infos über die aktuelle Ausgabe und kann die bisher erschienen Ausgaben online nachlesen, zum Preis von jeweils 1,50 Euro. Hier kann man auch den Newsletter bestellen, der dem Interessierten täglich Rezensionen und Nachrichten aus dem literarischen Leben der wichtigsten überregionalen Tageszeitungen per E-Mail frei Haus liefert.
Volltext erscheint 2monatlich zum Preis von 2,50 Euro, Jahresabonnement mit 10 Ausgaben 20,00 Euro.
VOLKER WEIDERMANN: Lichtjahre, eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute
Kurz ist sie in der Tat, die Literaturgeschichte, die der Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Literaturredakteur Volker Weidermann in seinem Buch LICHTJAHRE in weniger als 320 Seiten abhandelt, doch eines ist sie gewiss nicht: Eine Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute, jedenfalls nicht im Sinne eines Gesamtüberblicks, wie es der Untertitel suggeriert. Genau hier setzt sie auch an, die Kritik, die das Buch unmittelbar nach seinem Erscheinen überrollte (und ihm gleich zu großer Popularität verhalf). Zu oberflächlich sei es, zu anekdotenhaft, gar zu subjektiv und verkürzend in der Auswahl der Autoren. Ganze Strömungen und Epochen fehlten, war zu hören, bedeutende Namen seien nicht einmal erwähnt: Brigitte Kronauer, Hertha Müller und Günter Eich. Andere Größen der Literatur, seien mit nur wenigen Sätzen erwähnt, Paul Celan etwa und Bert Brecht. Einige Newcomer bedenke der Autor dagegen gleich mit vier, fünf Seiten: Christian Kracht, 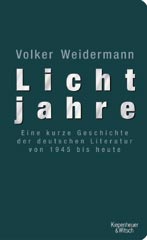 Rainald Goetz und Maxim Biller. (Natürlich kann keine Aufzählung so umfassend sein, dass der ambitionierte Leser nicht doch den einen oder anderen seiner persönlichen Lieblinge vermisst. Mir fehlen zum Beispiel die Namen Erich Loest, Dieter Wellershoff, Edgar Hilsenrath, Adolph Muschg, Bodo Kirchhoff, Gerhard Roth, Pascal Mercier, Hanns-Josef Ortheil, Ralf Rothmann, Hans-Ulrich Treichel und Thomas Lehr, um nur einige zu nennen.) Und überhaupt die Anekdoten, was interessiert denn den Leser die Farbe der Brust des ebenso größenwahnsinnigen wie großartigen Dichters Wolf Wondratschek, oder die Sprachkenntnisse der spanischen Freundin Daniel Kehlmanns? Alles in allem habe hier wohl nur ein Journalist seinen gut gefüllten Zettelkasten geplündert. - Ach, sie haben ja so recht, die allwissenden Kritiker.
Rainald Goetz und Maxim Biller. (Natürlich kann keine Aufzählung so umfassend sein, dass der ambitionierte Leser nicht doch den einen oder anderen seiner persönlichen Lieblinge vermisst. Mir fehlen zum Beispiel die Namen Erich Loest, Dieter Wellershoff, Edgar Hilsenrath, Adolph Muschg, Bodo Kirchhoff, Gerhard Roth, Pascal Mercier, Hanns-Josef Ortheil, Ralf Rothmann, Hans-Ulrich Treichel und Thomas Lehr, um nur einige zu nennen.) Und überhaupt die Anekdoten, was interessiert denn den Leser die Farbe der Brust des ebenso größenwahnsinnigen wie großartigen Dichters Wolf Wondratschek, oder die Sprachkenntnisse der spanischen Freundin Daniel Kehlmanns? Alles in allem habe hier wohl nur ein Journalist seinen gut gefüllten Zettelkasten geplündert. - Ach, sie haben ja so recht, die allwissenden Kritiker.
Und trotzdem: Ist es nicht das Recht eines jeden Autors, so subjektiv zu sein wie er will, hervorzuheben, wegzulassen, auszuwählen nach seinen, ausschließlich nach seinen eigenen Kriterien? Im Vorwort zitiert Weidermann Klabund, der über sein Buch DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE IN EINER STUNDE folgendes schrieb: Es ist das subjektive Begeisterungsbuch eines echten Lesers, der Zusammenhänge entdeckt, dringend empfiehlt, einteilt, urteilt und verurteilt, wie es ihm gefällt. Keinen Professoren verpflichtet, keiner Schule und keiner Wissenschaft. Nur sich selbst. Genau so will sich Weidermann verstanden wissen. Und weiter schreibt er: Es ist eine Auswahl. Ich halte sie für richtig, und niemand hat auf sie Einfluss genommen. Vielleicht wäre ein Untertitel wie “Ein Streifzug durch die deutsche Literatur ...“ oder wie im Vorwort beschrieben „Eine Auswahl ...“ treffender gewesen, statt des hier gewählten, eher der Verkäuflichkeit dienenden Titels.
Denn: Trotz allem ist Volker Weidermann mit LICHTJAHRE ein höchst spannendes und unterhaltsames Buch gelungen. Es gewährt einen überaus erfrischenden Zugang zur Literatur, kommt völlig unakademisch und locker daher, ist witzig und amüsant und vor allem: Es macht Appetit aufs Lesen. Weidermanns lakonischer Sprachstil wirkt belebend. Seine Sätze sind kurz und prägnant, im Ton manchmal ein wenig anmaßend aber immer direkt und unmissverständlich in der Aussage. Eher würde man diesen Stil im Feuilleton einer Zeitung vermuten als in einem Buch. Auch die anekdotischen Einsprengsel bereichern den Text. (Manche der 135 im Buch berücksichtigten Autoren hat Volker Weidermann im Rahmen seiner Tätigkeit als Redakteur selbst kennen gelernt.) Wer Weischedels PHILOSOPHISCHE HINTERTREPPE mag, wird auch an diesem Buch gefallen finden. Für mich ist LICHTJAHRE eines der Sachbücher, die es lohnen von der ersten bis zur letzten Seite gelesen zu werden. Ein kurzweiliger Schaufensterbummel durch die deutschsprachige Literatur und eine durchaus optimistische Antwort auf Heinz Schlaffers EINE KURZE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR - nicht mehr aber auch nicht weiniger. Und ich bin sicher: Um die Lücken zu schließen und am derzeitigen Verkaufserfolg anzuschließen wird es bald eine Fortsetzung geben.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, Hardcover, 324 Seiten, 19,90 Euro
Volker Weidermann: Das Buch der verbrannten Bücher
Als Fortsetzung seines erfolgreichen Buches LICHTJAHRE kann man den hier vorliegenden Band von Volker Weidermann sicherlich nicht bezeichnen, eher als Ergänzung. Ein Erinnerungsbuch ist es, gewidmet den Autorinnen und Autoren, deren Bücher 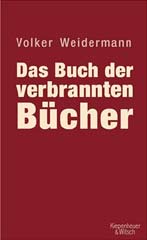 bei der von den Nazis angezettelten Bücherverbrennung im Mai 1933 auf dem Scheiterhaufen landeten, aber auch eine ebenso eindrucksvolle Fleißarbeit wie sein Vorgänger, denn … das vorliegende Buch beschreibt keinen Ausschnitt. Ich habe die Spuren ausnahmslos aller Autoren verfolgt, die damals auf der ersten schwarzen Liste der „Schönen Literatur“ standen, die als Grundlage für die Verbrennung diente. Vierundneunzig deutschsprachige Autoren stehen darauf und siebenunddreißig fremdsprachige… (aus dem Vorwort) Da sind sie dann alle versammelt, die großen und ganz großen der deutschsprachigen Literatur: Arnold Zweig, Remarque, Kisch, Oskar Maria Graf, Ringelnatz, Jakob Wassermann, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Feuchtwanger, Tucholsky, Heinrich Mann, Döblin, Brecht, Kästner, Alfred Kerr, Anna Seghers, Joseph Roth und die weniger bekannten, die Vergessenen: Edlef Köppen, Adrienne Thomas, Christa Anita Brück, Werner Türk, Leo Hirsch, Alexander Lernet-Holenia, Karl Schröder, Ludwig Renn, Arthur Holitscher, Alfred Schirokauer, Oskar Wöhrle und Arnold Ulitz. Noch ein Zitat aus dem Vorwort, in dem Volker Weidermann die Absicht seines Buches wie folgt beschreibt. … Die Vergessenen dem Vergessen zu entreißen, ihr Leben und ihre Bücher Ihnen, den Lesern von heute, wieder nahe zu bringen. Den Sieg der Bücherverbrennung in eine Niederlage zu verwandeln, die Bücher von damals in einem neuen Licht leuchten zu lassen und die dramatischen Geschichten zahlreicher Schriftstellerleben neu zu schreiben, Leben in der Entscheidung, Leben auf der Flucht, Leben, durch die jene Nacht im Mai wie ein Riss hindurchging. Ein Riss, der niemals ganz zu heilen war ... . In kurzen, leicht lesbaren Kapiteln stellt uns Volker Weidermann jeweils vier oder fünf thematisch verwandte Autoren und deren Lebenswege vor - ein spannender Spaziergang durch ein ganz besonderes Kapitel deutschsprachiger Literatur, und zudem ein brauchbares Nachschlagewerk.
bei der von den Nazis angezettelten Bücherverbrennung im Mai 1933 auf dem Scheiterhaufen landeten, aber auch eine ebenso eindrucksvolle Fleißarbeit wie sein Vorgänger, denn … das vorliegende Buch beschreibt keinen Ausschnitt. Ich habe die Spuren ausnahmslos aller Autoren verfolgt, die damals auf der ersten schwarzen Liste der „Schönen Literatur“ standen, die als Grundlage für die Verbrennung diente. Vierundneunzig deutschsprachige Autoren stehen darauf und siebenunddreißig fremdsprachige… (aus dem Vorwort) Da sind sie dann alle versammelt, die großen und ganz großen der deutschsprachigen Literatur: Arnold Zweig, Remarque, Kisch, Oskar Maria Graf, Ringelnatz, Jakob Wassermann, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Feuchtwanger, Tucholsky, Heinrich Mann, Döblin, Brecht, Kästner, Alfred Kerr, Anna Seghers, Joseph Roth und die weniger bekannten, die Vergessenen: Edlef Köppen, Adrienne Thomas, Christa Anita Brück, Werner Türk, Leo Hirsch, Alexander Lernet-Holenia, Karl Schröder, Ludwig Renn, Arthur Holitscher, Alfred Schirokauer, Oskar Wöhrle und Arnold Ulitz. Noch ein Zitat aus dem Vorwort, in dem Volker Weidermann die Absicht seines Buches wie folgt beschreibt. … Die Vergessenen dem Vergessen zu entreißen, ihr Leben und ihre Bücher Ihnen, den Lesern von heute, wieder nahe zu bringen. Den Sieg der Bücherverbrennung in eine Niederlage zu verwandeln, die Bücher von damals in einem neuen Licht leuchten zu lassen und die dramatischen Geschichten zahlreicher Schriftstellerleben neu zu schreiben, Leben in der Entscheidung, Leben auf der Flucht, Leben, durch die jene Nacht im Mai wie ein Riss hindurchging. Ein Riss, der niemals ganz zu heilen war ... . In kurzen, leicht lesbaren Kapiteln stellt uns Volker Weidermann jeweils vier oder fünf thematisch verwandte Autoren und deren Lebenswege vor - ein spannender Spaziergang durch ein ganz besonderes Kapitel deutschsprachiger Literatur, und zudem ein brauchbares Nachschlagewerk.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, Hardcover, 253 Seiten, 18,95 Euro
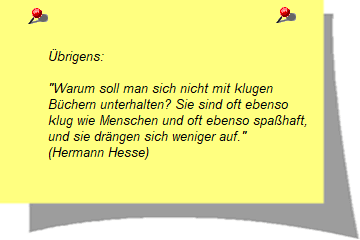 |
Klaus Willbrand und Daria Razumovych: Einfach Literatur, eine Einladung
Klaus Willbrand kennt man von zahlreichen Videoclips auf Instagram und TikTok. Dort ist er ein Star mit 100.000 Followern. In den von Daria Razumovych produzierten Videos spricht der über Achtzigjährige verständlich und mit großem Sachverstand über Werke der Weltliteratur, bedeutende und überschätzte Autoren/innen, Bücher für die Insel und seine eigenen Leseerfahrungen. Der Vorschlag des S. Fischer Verlags, aus all dem ein Buch zu machen, war die logische Konsequenz dieses Erfolgs.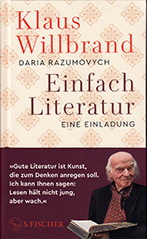 Das schmale Büchlein, das wir nun vor uns haben, ähnelt in großen Teilen den Leselisten, die wir bereits kennen. Denn auch Willbrand schätzt die Klassiker der Weltliteratur: Kafka, Proust, Thomas Mann, Emily Dickinson, Musil, Joyce, Pound, Sehers, Koeppen, Böll, Grass … Und doch geht von diesem Buch ein Zauber aus, nämlich immer dann, wenn Willbrand über sich selber spricht, wenn er erzählt, wie er zur Literatur gefunden hat, wie er zum Buchhändler wurde und welche Begegnungen mit zeitgenössischen Autoren ihn geprägt haben: das Trinkgelage mit H.C. Artmann, die kurze Begegnung mit Günter Grass und seine innige Freundschaft mit Rolf Dieter Brinkmann, dessen Förderer er war.
Das schmale Büchlein, das wir nun vor uns haben, ähnelt in großen Teilen den Leselisten, die wir bereits kennen. Denn auch Willbrand schätzt die Klassiker der Weltliteratur: Kafka, Proust, Thomas Mann, Emily Dickinson, Musil, Joyce, Pound, Sehers, Koeppen, Böll, Grass … Und doch geht von diesem Buch ein Zauber aus, nämlich immer dann, wenn Willbrand über sich selber spricht, wenn er erzählt, wie er zur Literatur gefunden hat, wie er zum Buchhändler wurde und welche Begegnungen mit zeitgenössischen Autoren ihn geprägt haben: das Trinkgelage mit H.C. Artmann, die kurze Begegnung mit Günter Grass und seine innige Freundschaft mit Rolf Dieter Brinkmann, dessen Förderer er war.
Ein kleines aber feines Buch.
Nachtrag: Klaus Willbrand hat die Fertigstellung
seines Buches nicht mehr erlebt. Er starb im Januar 2025.
S. Fischer Verlag, 2025; Hardcover, 220 Seiten, 22 Euro
Uwe Wittstock: Die Büchersäufer - Streifzüge durch den Literaturbetrieb
Der vorliegende Band möchte mit einigen Streifzügen durch das Milieu bekennender Büchersäufer - dem von Experten sogenannten Literaturbetrieb - den Blick für Gefahren der Lesesucht schärfen. Dieser Satz aus dem Vorwort stimmt natürlich so nicht. Hier wird kein Krankheitsbild vorgestellt, das es zu überwinden gilt.  Und schließlich wird Literatur immer noch von Menschen gemacht, von solchen zum Beispiel, denen Wittstock in seinem Buch ein eigenes Kapitel widmet: Bernd F. Lunkewitz (Der Retter des Aufbau Verlags), Gerd Haffmans, Daniela Seel (Kookbooks), Benedikt Taschen (Kunstbücher) und natürlich Siegfried Unseld. Mit der Kasseler Buchhändlerin Gerda Brencher und dem Kölner Klaus Bittner porträtiert Wittstock liebevoll zwei Enthusiasten des Buchhandels um sich sogleich zweier Giganten im Buchgeschäft zu widmen: Thalia und Weltbild. “Nachrichten vom Genre” nennt Wittstock das zweite große Kapitel seines Buches, darin kurze Betrachtungen zum Thema Kriminal- und Liebesroman, der Neuen Frankfurter Schule (Bernd Eilert, Robert Gernhardt, F.K. Waechter), Porträts der Zeichner und Cartoonisten Bernd Pfarr und Volker Reiche, dem Karikaturistenduo Greser & Lenz, sowie den ehemaligen Titanic-Machern Oliver Maria Schmitt und Martin Sonneborn. Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass es sich auch in diesem Fall um eine Sammlung von Aufsätzen handelt, die in den meisten Fällen bereits in anderen Printmedien erschienen sind, so der Welt, der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie der Zeitschrift Sports. Letzterer entstammt übrigens auch der Text “Literatur und Leibesübungen. Fünf Trainingseinheiten”, der dem Thema durchaus noch angemessen ist. Aber was bitteschön hat der Aufsatz über das Billy-Regal von Ikea in diesem Buch verloren?
Und schließlich wird Literatur immer noch von Menschen gemacht, von solchen zum Beispiel, denen Wittstock in seinem Buch ein eigenes Kapitel widmet: Bernd F. Lunkewitz (Der Retter des Aufbau Verlags), Gerd Haffmans, Daniela Seel (Kookbooks), Benedikt Taschen (Kunstbücher) und natürlich Siegfried Unseld. Mit der Kasseler Buchhändlerin Gerda Brencher und dem Kölner Klaus Bittner porträtiert Wittstock liebevoll zwei Enthusiasten des Buchhandels um sich sogleich zweier Giganten im Buchgeschäft zu widmen: Thalia und Weltbild. “Nachrichten vom Genre” nennt Wittstock das zweite große Kapitel seines Buches, darin kurze Betrachtungen zum Thema Kriminal- und Liebesroman, der Neuen Frankfurter Schule (Bernd Eilert, Robert Gernhardt, F.K. Waechter), Porträts der Zeichner und Cartoonisten Bernd Pfarr und Volker Reiche, dem Karikaturistenduo Greser & Lenz, sowie den ehemaligen Titanic-Machern Oliver Maria Schmitt und Martin Sonneborn. Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass es sich auch in diesem Fall um eine Sammlung von Aufsätzen handelt, die in den meisten Fällen bereits in anderen Printmedien erschienen sind, so der Welt, der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie der Zeitschrift Sports. Letzterer entstammt übrigens auch der Text “Literatur und Leibesübungen. Fünf Trainingseinheiten”, der dem Thema durchaus noch angemessen ist. Aber was bitteschön hat der Aufsatz über das Billy-Regal von Ikea in diesem Buch verloren?
zu Klampen Verlag, Springe 2007, gebunden, 173 Seiten, 16 Euro
DIE ZEIT: ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher,
herausgegeben von Fritz J. Raddatz
Auch dieses Buch geht zurück auf eine in der Wochenzeitschrift DIE ZEIT erschienen Serie aus den Jahren 1978 bis 1980. In 100 einzelnen Artikel wurden damals 100 Werke der Weltliteratur vorgestellt, von der Bibel bis zu Uwe Johnson, von A wie Andersen bis Z wie Zola. Lesen kann man lernen. Immer und immer wieder - ob in Leserbriefen, Fernsehdiskussionen oder Seminaren - wird die Frage vorgetragen: “Wie orientiere ich mich angesichts der Bücherflut - wie bekomme ich einen Zugang zur Literatur, wo fange ich an? Eine sechsköpfige Jury - Rudolf Walter Leonhardt, Hans Mayer, Rolf Michaelis, Fritz J. Raddatz, Peter Wabnewski, Dieter E. Zimmer - wagte darauf eine Antwort: Bekannte Schriftsteller und Essayisten haben jeweils ein Buch dieser Bibliothek vorgestellt und porträtiert. Diese literarische und literaturkritische Anthologie ist ein Kompendium besonderer Art, ein Einstieg in die Literatur. (Klappentext) Dabei liegt der Schwerpunkt erfreulicherweise auf der erzählenden Literatur. Es kommen weder Dramen noch Gedichte noch Sachbücher vor. Shakespeare, Brecht und Co. fehlen ganz. Dabei schwebte der Redaktion gar kein Kanon im herkömmlichen Sinne vor. Wir hatten uns vorgestellt, dass jemand gezwickt wird, aufgestachelt, vielleicht einem ganz anderen Buch (anderen Büchern?) sich auszusetzen, anderen Autoren - vielleicht dem `Tonio Kröger´ statt der `Buddenbrooks´, vielleicht Arno Schmidt statt Günter Grass. Und trotzdem ist es doch irgendwie ein Kanon geworden - einer mit 100 wertvollen Empfehlungen für uns Leser.
Lesen kann man lernen. Immer und immer wieder - ob in Leserbriefen, Fernsehdiskussionen oder Seminaren - wird die Frage vorgetragen: “Wie orientiere ich mich angesichts der Bücherflut - wie bekomme ich einen Zugang zur Literatur, wo fange ich an? Eine sechsköpfige Jury - Rudolf Walter Leonhardt, Hans Mayer, Rolf Michaelis, Fritz J. Raddatz, Peter Wabnewski, Dieter E. Zimmer - wagte darauf eine Antwort: Bekannte Schriftsteller und Essayisten haben jeweils ein Buch dieser Bibliothek vorgestellt und porträtiert. Diese literarische und literaturkritische Anthologie ist ein Kompendium besonderer Art, ein Einstieg in die Literatur. (Klappentext) Dabei liegt der Schwerpunkt erfreulicherweise auf der erzählenden Literatur. Es kommen weder Dramen noch Gedichte noch Sachbücher vor. Shakespeare, Brecht und Co. fehlen ganz. Dabei schwebte der Redaktion gar kein Kanon im herkömmlichen Sinne vor. Wir hatten uns vorgestellt, dass jemand gezwickt wird, aufgestachelt, vielleicht einem ganz anderen Buch (anderen Büchern?) sich auszusetzen, anderen Autoren - vielleicht dem `Tonio Kröger´ statt der `Buddenbrooks´, vielleicht Arno Schmidt statt Günter Grass. Und trotzdem ist es doch irgendwie ein Kanon geworden - einer mit 100 wertvollen Empfehlungen für uns Leser.
Ein paar Beispiele aus dem Inhalt: Homer, Odyssee (Herbert Bannert); Tacitus, Germania (Heinrich Böll); Augustinus, Bekenntnisse (Golo Mann); Thomas Morus, Utopia (Rudolf Augstein); Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Ulrich Greiner); Giacomo Casanova, Geschichte meines Lebens (Manès Sperber); Herman Melville, Moby Dick (Rolf Hochhuth); Gustave Flaubert, Madame Bovary (Eberhard Lämmert); Fjodor M. Dostojewskij, Die Dämonen (Luise Rinser); John Dos Passos, Manhattan Transfer (Siegfried Lenz); Heinrich Böll, Erzählungen (Wolfgang Weyrauch); Günter Grass, Die Blechtrommel ( Fritz J. Raddatz)
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980, st645, 450 Seiten, 12,50 Euro
DIE ZEIT: Hundert Gefährten fürs Leben,
von Adam Soboczynski und Volker Weidermann 40 Jahre nach Fritz J. Raddatz’ erstem Kanon dachten sich die ZEIT-Redakteure Adam Soboczynski und Volker Weidermann, dass es nun wohl angebracht sei, einen neuen, zeitgemäßen Kanon zu präsentieren. Am 25. November 2023 erschien eine umfangreiche ZEIT-Sonderausgabe mit dem Titel „Hundert Gefährten fürs Leben“. Hundert Werke der Weltliteratur, zusammengefasst in sieben Kapiteln, die die Überschriften tragen Angst, Nacht, Trauer, Verirrt, Sex, Wer bin ich? und Aufbruch. Viele unserer alten Bekannten sind wieder dabei (Natürlich, deshalb nennen wir sie ja Klassiker: Homer, Dante, Goethe, Moritz, Melville, Flaubert, Musil, Kafka, Grass …). Einige Altgediente haben uns aus Altersgründen verlassen (Vergil, Defoe, Schiller, Kleist, Casanova, Hölderlin, Dickens, Stifter, Tolstoi, Zola, Marx, Hamsun, Rilke, Johnson …). Als glückliche Aufsteiger in die erste Liga können sich unter anderen freuen: Isabel Allende, Olga Tokarczuk, Haruki Murakami, Zadie Smith, Eva Menasse, David Foster Wallace, Serhij Zhadan, Arundhati Roy, Agota Kristof, Jonathan Franzen, Judith Hermann, Daniel Kehlmann, Michel Houellebecq, Annie Ernaux, Christian Kracht, Lutz Seiler, J.K. Rowling und viele mehr. Viele der einhundert Texte sind recht kurz gehalten, manche erstrecken sich dagegen über eine ganze Zeitungsseite. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie von namhaften Personen des Literaturbetriebs verfasst worden sind, viele davon selbst Autorinnen und Autoren weitbekannter Werke, wie Eva Menasse, Daniel Kehlmann, Günter Wallraff, Elke Schmitter, Clemens J. Setz, Karl-Markus Gauß, Frank Schätzing, Eugen Ruge, Elke Heidenreich, Wolf Haas und viele andere.
40 Jahre nach Fritz J. Raddatz’ erstem Kanon dachten sich die ZEIT-Redakteure Adam Soboczynski und Volker Weidermann, dass es nun wohl angebracht sei, einen neuen, zeitgemäßen Kanon zu präsentieren. Am 25. November 2023 erschien eine umfangreiche ZEIT-Sonderausgabe mit dem Titel „Hundert Gefährten fürs Leben“. Hundert Werke der Weltliteratur, zusammengefasst in sieben Kapiteln, die die Überschriften tragen Angst, Nacht, Trauer, Verirrt, Sex, Wer bin ich? und Aufbruch. Viele unserer alten Bekannten sind wieder dabei (Natürlich, deshalb nennen wir sie ja Klassiker: Homer, Dante, Goethe, Moritz, Melville, Flaubert, Musil, Kafka, Grass …). Einige Altgediente haben uns aus Altersgründen verlassen (Vergil, Defoe, Schiller, Kleist, Casanova, Hölderlin, Dickens, Stifter, Tolstoi, Zola, Marx, Hamsun, Rilke, Johnson …). Als glückliche Aufsteiger in die erste Liga können sich unter anderen freuen: Isabel Allende, Olga Tokarczuk, Haruki Murakami, Zadie Smith, Eva Menasse, David Foster Wallace, Serhij Zhadan, Arundhati Roy, Agota Kristof, Jonathan Franzen, Judith Hermann, Daniel Kehlmann, Michel Houellebecq, Annie Ernaux, Christian Kracht, Lutz Seiler, J.K. Rowling und viele mehr. Viele der einhundert Texte sind recht kurz gehalten, manche erstrecken sich dagegen über eine ganze Zeitungsseite. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie von namhaften Personen des Literaturbetriebs verfasst worden sind, viele davon selbst Autorinnen und Autoren weitbekannter Werke, wie Eva Menasse, Daniel Kehlmann, Günter Wallraff, Elke Schmitter, Clemens J. Setz, Karl-Markus Gauß, Frank Schätzing, Eugen Ruge, Elke Heidenreich, Wolf Haas und viele andere.
Natürlich lässt sich nach wie vor über Sinn und Unsinn solcher Leselisten streiten. In jedem Fall aber bietet ein Kanon Anregungen und Gesprächsstoff. Und das ist doch schon mal was.
DIE ZEIT, Sonderausgabe vom 25. November 2023.
Die Hardcover-Ausgabe (320 Seiten, 25 Euro) unter: shop.zeit.de/100.
Link: Wikipedia ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher
René Zey:
Rätsel aus der Welt der Literatur - 500 Quizfragen für Bücherfreunde
Hier das erste von mehreren kleinen Schmankerln: literarische Quizfragen.
Wissen Sie wie der einzige Roman von Sylvia Plath heißt, was der Fischer in Hemingways Roman “Der alte Mann und das Meer” fängt, wer der Henker ist in Friedrich Dürrenmatts Roman “Der Richter und sein Henker”, oder mit welchem Satz Kafkas Roman “Der Prozess” beginnt? Zugegeben, nicht alle Fragen in René Zeys Büchlein sind so einfach wie diese hier, aber vergnüglich und unterhaltsam sind sie allesamt. Denn, in den 500 Fragen geht es um berühmte Autoren, Figuren und Schauplätze der Weltliteratur, um Titel und Untertitel, um Romanfortsetzungen, Mythen, Märchen, Zitate, Buchmessen, Literaturpreise und Verlage. In jeder dieser Fragen wird das Erinnerungsvermögen gefordert, das Wissen um Ich-Erzähler, Pseudonyme, bestimmte Passagen oder spezielle Genres. Doch Achtung: auf der Suche nach der richtigen Antwort müssen Sie nicht Ihre Bibliothek oder gar das Internet durchforsten. Keine Angst, im Lösungsteil des Buches ist jede Antwort akribisch aufgelistet und wenn nötig auch kommentiert. Übrigens, ein Schwertfisch ist es, was der Fischer im Hemingway-Roman fängt. Hätten Sie’s gewusst?
Falken-Verlag, Niedernhausen/Ts, 2000, Paperback, 80 Seiten, 8,64 Euro
Christiane Zschirnt: Bücher - alles, was man lesen muss
Nicht nur äußerlich ähnelt das Buch von Christiane Zschirnt dem ebenfalls im Eichborn Verlag erschienene Bildungsklassiker von Dietrich Schwanitz (von ihm stammt auch das Vorwort). So kann man es denn auch als Fortsetzung, oder besser als umfangreiche Neufassung seines Kapitels über Literatur betrachten. Also noch einmal das Wagnis Literaturkanon. Ich habe dieses Buch für alle geschrieben, die sich auf dem Ozean (der Literatur) zurechtfinden wollen. Es ist ein Buch über Texte, die Spuren in der westlichen Kultur hinterlassen haben. Sie enthalten das kulturelle 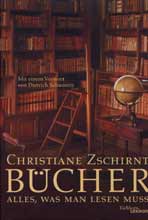 Wissen der westlichen Welt: es sind Romane, Dramen, Epen, theoretische Abhandlungen und Aufsätze. (...) Dieses Buch soll Sie mit dem Kompass ausstatten, den Sie benötigen, wenn Sie sich aufs Meer hinaus wagen, um eigene Entdeckungen zu machen. (aus der Einleitung) Und doch wählt Christiane Zschirnt eine andere Methode, sich dem Thema zu nähern, als andere vor ihr. Statt sich chronologisch durch die Weltliteratur, sprich vom Alten Testament zur Blechtrommel zu bewegen, ordnet sie ihre Lieblinge in folgende Kategorien ein: Werke, die die Welt beschreiben, Liebe, Politik, Sex, Wirtschaft, Frauen, Zivilisation, Psyche, Shakespeare, Moderne, Trivialklassiker, Kultbücher, Utopie: Cyberworld, Schulklassiker und Kinder. Dieses Ordnungsprinzip bietet erfreulicherweise auch Raum für Heldinnen und Helden, deren Namen man in literarischen Bestenlisten sonst eher selten antrifft: Adam Smith, Karl Marx, de Sade, Alice Schwarzer, Margaret Mitchell, Karl May, Douglas Coupland, William Gibson sowie Donald Duck, Harry Potter und Pippi Langstrumpf. Einerseits gehen die zwei- bis dreiseitigen Einzelkapitel über eine reine Inhaltsangabe des betreffenden Werkes mitunter nicht hinaus, andererseits tritt verblüffendes zutage, wenn wir zum Beispiel privates über die erwachsene Pippi Langstrumpf erfahren oder wenn wir Robinson Crusoe im Kapitel Wirtschaft wiederfinden und Frau Zschirnt über Defoes Schulden und Robinsons Schuld philosophiert.
Wissen der westlichen Welt: es sind Romane, Dramen, Epen, theoretische Abhandlungen und Aufsätze. (...) Dieses Buch soll Sie mit dem Kompass ausstatten, den Sie benötigen, wenn Sie sich aufs Meer hinaus wagen, um eigene Entdeckungen zu machen. (aus der Einleitung) Und doch wählt Christiane Zschirnt eine andere Methode, sich dem Thema zu nähern, als andere vor ihr. Statt sich chronologisch durch die Weltliteratur, sprich vom Alten Testament zur Blechtrommel zu bewegen, ordnet sie ihre Lieblinge in folgende Kategorien ein: Werke, die die Welt beschreiben, Liebe, Politik, Sex, Wirtschaft, Frauen, Zivilisation, Psyche, Shakespeare, Moderne, Trivialklassiker, Kultbücher, Utopie: Cyberworld, Schulklassiker und Kinder. Dieses Ordnungsprinzip bietet erfreulicherweise auch Raum für Heldinnen und Helden, deren Namen man in literarischen Bestenlisten sonst eher selten antrifft: Adam Smith, Karl Marx, de Sade, Alice Schwarzer, Margaret Mitchell, Karl May, Douglas Coupland, William Gibson sowie Donald Duck, Harry Potter und Pippi Langstrumpf. Einerseits gehen die zwei- bis dreiseitigen Einzelkapitel über eine reine Inhaltsangabe des betreffenden Werkes mitunter nicht hinaus, andererseits tritt verblüffendes zutage, wenn wir zum Beispiel privates über die erwachsene Pippi Langstrumpf erfahren oder wenn wir Robinson Crusoe im Kapitel Wirtschaft wiederfinden und Frau Zschirnt über Defoes Schulden und Robinsons Schuld philosophiert.
Fazit: Wieder ein Buch für die literarische Diskussion, aber ein lesenswertes Buch auf alle Fälle.
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2002, 330 Seiten, 21,90 Euro.
www.eichborn-verlag.de